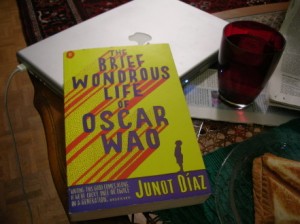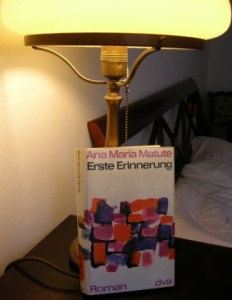Der Tod und das Mädchen*
3. July 2010 | von KaltmamsellMarkus Zusak, The Book Thief

Wenn ein Buch seit Jahren als Weltbestseller gelistet ist – braucht diese Welt dann überhaupt eine weitere Besprechung, noch dazu von einer gewöhnlichen Leserin? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber, hey!, das hier ist Bloggen.
Eine Freundin des Mitbewohners hatte den Roman empfohlen: Ein australischer Autor schreibt eine Geschichte, die in den frühen 40ern im nahegelegenen Fürstenfeldbruck spielt – hörte sich attraktiv abgefahren an. Und stellte sich als ausgezeichnet gebaute und sehr gut erzählte Geschichte heraus.
Fürstenfeldbruck wird in The Book Thief zu Molching. In Deutschland scheint das bereits jeder zu wissen, ich nehme an, es steht auf der Übersetzung (die mich ohnehin sehr interessiert). Doch erst mal lernen wir im Prolog einen höchst auktorialen Ich-Erzähler kennen: den Tod. Er stellt sich vor, korrigiert ein paar Vorurteile über sich, gibt den scheinbar leichten und humorvollen Plauderton der Geschichte vor, und er führt ein typografisches Feature ein, dass sich durch das ganze Buch zieht: fett gedruckte, kurze erklärende Einschübe mit Überschrift, zum Beispiel
HERE IS A SMALL FACT
You are going to die
Sie werden später für Nebengedanken genutzt, Lexikonerklärungen, Fußnoten.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht – neben dem dem Tod – Liesel, die 1939 im Alter von neun Jahren von ihrer Mutter bei Pflegeeltern in Molching abgegeben wird. Sie ist ein verstörter und traumatisierter Mensch mit ungeheurer innerer Kraft. Der Roman erzählt ihre Geschichte hauptsächlich bis zu einer entsetzlichen Bombennacht 1943. Dabei lernen wir unter anderem ihre Arbeiter-Pflegeeltern kennen, die ruppige Rosa Hubermann und den sanften und zugewandten Maler Hans Hubermann, zudem den gleichaltrigen Nachbarsbuben Rudy Steiner, der auf den ersten Blick ihr bester und treuester Freund wird, den jungen jüdischen Mann Max, im Keller der Hubermanns versteckt, die eigenartig abwesende Frau des Bürgermeisters, die sich auf sehr besondere Weise Liesels Bücherhungers annimmt. Denn den hat Liesel, noch bevor sie richtig lesen kann, und er macht sie zur titelgebenden Bücherdiebin.
Schon mit dem Titel muss die deutsche Übersetzung mehr verraten als das Original: das Geschlecht der Hauptfigur. Die Geschichte ist durchzogen mit deutschen und bayrischen Wörtern, die immer wieder auch in Einschüben übersetzt und erklärt werden, die erwachsenen Figuren heißen alle Herr oder Frau statt Mr und Mrs.
Markus Zusak nimmt uns in eine Zeit und eine Gegend mit, die ich seit meiner Kindheit aus den Erzählungen alter Leute kenne: Hunger und Armut gehören zum Alltag, jugendliche Diebesbanden plündern Obstgärten, der Unterschied zwischen den gesellschaftlichen Schichten ist hart und deutlich, der moralische Code rigide und unmenschlich. Und weil wir in Fürstenfeldbruck sind, sehen wir immer wieder Gruppen von jüdischen Gefangenen auf ihrem Fußmarsch nach Dachau.
Was mich besonders begeisterte: Endlich eine Heldin nach meinem Geschmack. Wir sehen einer 9- bis 14jährigen zu, die Fußball spielt, liest, hinguckt, ihre Freiräume genauso verteidigt wie ihre Lieben – notfalls mit Fäusten, die mal hilflos ist und mal entschlossen, mit schrecklichen Alpträumen ebenso fertig wird wie mit eigenartigen Erwachsenen.
Anfangs irritierte mich der zeitweilige Kinderbuchtonfall des Buches. Doch er funktioniert inhaltlich, vor allem wenn damit innere menschlichen Konflikte erklärt werden, zum Beispiel die Gewissenskonflikte von manchen Erwachsenen im 3. Reich. Wenn schon telling statt showing, dann lieber so deutlich markiert. Überhaupt gibt es fast keine personale Innensicht der Personen, fast alles wird durch Handlung gezeigt oder vom Erzähler erklärt. In dieser leicht märchenhaften Erzählweise (die an ein paar Stellen ziemlich dick aufgetragen ist) bereitet uns der Tod auch auf schreckliche Ereignisse vor; dass Rudy das Erwachsenenenalter nicht erreichen wird, erfahren wir zum Beispiel bereits kurz nach seiner Vorstellung, ebenso, dass die Bombardierungen durch die Alliierten die Szenerie der Geschichte zerstören werden.
Diese Mischung von Erzählweise aus dem 19. Jahrhundert (inklusive chirurgisch präzisem Druck auf die Tränendrüsen) und moderner Charakterisierung erinnerte mich sehr an John Irving; und vermutlich werde ich bei Schilderungen von verheerenden Bombennächten in Deutschland immer an Kurt Vonneguts Slaughterhouse Five denken.
Ob jetzt wohl ein Literaturtourismus nach Fürstenfeldbruck beginnt?
* Ich kenne die Presseberichterstattung über das Buch nicht, nehme aber an, dass jeder zweite Schreiber zu dieser Überschrift gegriffen hat.


 Es gibt Leute, die die Klagenfurter „Tage der deutschsprachigen Literatur“, vulgo den Bachmannpreis, leben und feiern wie andere Leute (viel, viel mehr Leute) die Fußballweltmeisterschaft – ein mir ausgesprochen sympathisches Spinnertum. Seit 2004 gehört auch Angela Leinen dazu, die ich als Autorin des Blogs
Es gibt Leute, die die Klagenfurter „Tage der deutschsprachigen Literatur“, vulgo den Bachmannpreis, leben und feiern wie andere Leute (viel, viel mehr Leute) die Fußballweltmeisterschaft – ein mir ausgesprochen sympathisches Spinnertum. Seit 2004 gehört auch Angela Leinen dazu, die ich als Autorin des Blogs