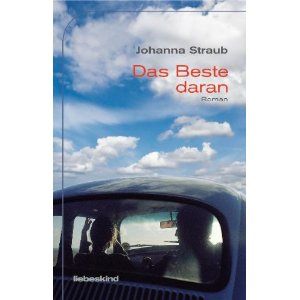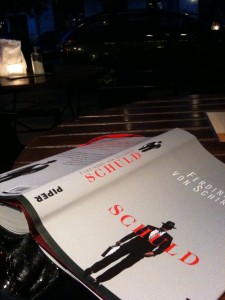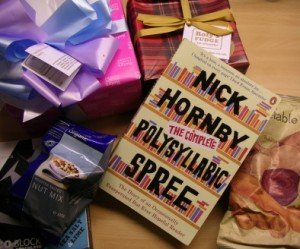Misanthropie und Romantik
17. November 2010 | von Kaltmamsell
Sibylle Berg, Der Mann schläft
Die Misanthropin, die als Erzählerin im Zentrum von Sibylle Bergs Der Mann schläft von 2010 steht, hat mich meist an Else Buschheuer erinnerte, manchmal auch an Frau Modeste, hin und wieder an Frau Gaga. So sehr war noch keine meiner Buchlektüren von Blogleserei beeinflusst. Else Buchheuer äußert ihre Unbehagen den Menschen gegenüber inzwischen hauptsächlich bei Twitter (z.B. „merke: auf die einleitungsfrage‚ darf ich offen zu Ihnen sein?‘ stets frenetisch den kopf schütteln!“). Frau Modeste ist den Menschen erheblich zugetaner, leidet aber doch hin und wieder an den Durchschnittsexemplaren der Gattung. Gaga wiederum hat kürzlich einige anerzogene Hemmung fallengelassen und zugegeben, wie sehr sie oft menschliche Kontakte als Belästigung empfindet.
Die Erzählerin ist eine nicht mehr junge Frau, die bis in ihr Innerstes am liebsten für sich ist. Die Grundtriebe nötigen sie dazu, ihre Wohnung hin und wieder zu verlassen und mit Menschen in Kontakt zu treten, doch selbst diese Interaktionen kosten sie immer mehr Energie. Das macht die Fassungslosigkeit nachvollziehbar, mit der diese Frau eines Tages vor der Entdeckung steht, dass es einen Menschen gibt, der sie überhaupt nicht stört, in dessen Anwesenheit sie sich sogar wohler fühlt als in dessen Abwesenheit, um den sie sich sorgt, den sie auch ohne erotisches Begehren physisch herbeisehnt.
Die Geschichte hat zwei Handlungsstränge, die einander kapitelweise abwechseln: Der eine beginnt vor vier Jahren und erzählt die Zeit, in der die Ich diesen Mann kennenlernte und ein Leben mit ihm begann. Der zweite spielt in der Gegenwart auf einer Insel vor Hongkong, auf der sich die Frau jetzt ohne den Mann befindet. Die Vergangenheit erzählt sie bis heran an die Gegenwart, in den letzten Kapiteln decken sich die Stränge. Im Zentrum stehen die Liebe und der unerträgliche Schmerz der Erzählerin, erzeugt durch die Lücke, die die Abwesenheit des Mannes hinterlassen hat.
Wieder wünschte ich, ich hätte den Klappentext nicht gelesen: Er nimmt als Tatsache vorweg, was der Roman zumindest im ersten Drittel lediglich als Möglichkeit durchscheinen lässt, nämlich was mit dem titelgebenden Mann, der schläft, los ist. Kann sich eine Autorin dagegen nicht wehren? Hat man ihr erklärt, das Buch werde sich nicht verkaufen, wenn dem Klappentext diese Schlüsselinformation fehlt? Zum wiederholten Mal nehme ich mir vor, Klappentexte erst nach der Lektüre eines Romans zu lesen.
Die Erzählerin drückt sich ausgesprochen manieriert aus – sie scheint nicht nur der Menschen, sondern auch ihrer heimeligsten Wörter überdrüssig. Manchmal treibt sie das bis hart an die Grenze des Hinnehmbaren, zum Beispiel wenn sie einen fehlgeschlagenen Morgengruß mit „versuche ich ihr die Tageszeit zuzuraunen“ ausdrückt.
Fast keine der Personen hat einen Namen, sie sind „der Mann“, „der Masseur“, „die schwierige Bekannte“, „der unsichtbare Herr“, „die Prostituierte“. Ausnahmen sind ein Mädchen namens Kim und ein Cafébesitzer Jack. Die Geschichte all dieser Menschen sind Teil des Romans, mal mehr, mal weniger konventionell erzählt.
Eigentümlich ist der Roman, doch ist er surreal oder bloß nicht-realistisch? Viele Details sind bizarr, zum Beispiel spielen selbst gebaute Archen / Raumschiffe und Ritualmorde eine Rolle. Und die Wahrnehmung der Erzählerin entzieht sich gerne mal normaler Überprüfbarkeit – wenn sie zum Beispiel beiläufig berichtet, dass sie durch ein Fenster einen aus der Schule heimkehrenden Buben beobachtet, der seine Großmutter umarmt und ihr dann ein Beil in den Kopf schlägt. Andere Details wieder widersetzen sich einfach den Erwartungen an realistisches Erzählen: Geld kommt im ganzen Roman nicht vor, nie wird etwas bezahlt, und die materielle Grundlage für einen monatelangen Aufenthalt auf einer asiatischen Ferieninsel ist kein Thema.
Dann wiederum liefert die Geschichte die realistischste Beschreibung von Liebe, die ich je gelesen habe. So kam ich ja auch auf das Buch: über ein Interview mit Sibylle Berg. Die Klischeeliebe der Filme, der Musiktexte, der Werbung will uns nur Dinge und Dienstleitungen verkaufen, so erzählt es auch der Roman – es ist völlig hirnrissig, sich zur Sehnsucht nach dieser Klebrigkeit manipulieren zu lassen. Die Liebe in Der Mann schläft, die einfach dafür sorgt, dass es jemandem dauerhaft besser geht, kommt in der Literatur kaum vor (obwohl sie durchaus romantisch im kulturhistorischen Sinn ist und irrational).