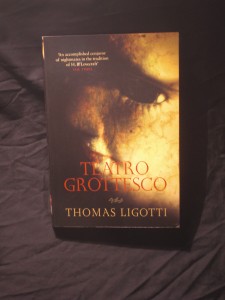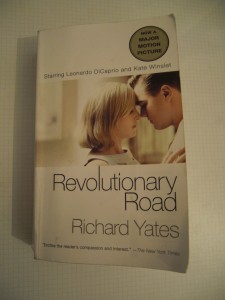Deutsche Nachkriegsgeschichte, bevor Guido Knopp sie erfand
16. March 2011 | von Kaltmamsell Hans Scholz, Am grünen Strand der Spree
Hans Scholz, Am grünen Strand der Spree
(Antiquarisches Buch in 50er-Arrangement, der Geflügelsalat wird explizit erwähnt.)
Auf Am grünen Strand der Spree brachte mich ein SZ-Artikel zum 100. Geburtstag von Hans Scholz: Nachkriegsberlin als Ort eines Episodenromans von 1955 klang interessant. Und nun verzeichne ich einen neunen Meilenstein in meiner persönlichen Lesegeschichte.
(Warnung: Der Wikipedia-Eintrag gleichen Titels bespricht die Fernsehverfilmung von 1960 und verrät alles.)
Der Rahmen der Handlung ist ein Treffen alter Freunde in einer westberliner Bar der früheren 50er. Der Erzähler ist ein Hans Schott, der den Auftrag hat, den aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Hans-Joachim Lepsius aufzumuntern – muss dieser doch nach den Grauen der vorhergegangenen Jahre auch noch das Scheitern seiner Ehe verarbeiten.
In dieser Bar, dem Jockey-Club (unbedingt deutsch auszusprechen), ist die Stimmung zunächst ein wenig steif. Aber schon in dieser Phase erinnerte mich die Art der sprachlichen Launigkeit sehr an Walter Kempowskis Tadellöser & Wolff; im weiteren Verlauf des Romans erklingt dann auch „immerhinque!“. Die Herren haben sich als Programm vorgenommen, einander Geschichten zu erzählen. Lepsius hat die Aufzeichnungen des gemeinsamen Freundes Jürgen Wilms dabei, den er in russischer Gefangenschaft zurücklassen musste. Er liest sie vor: Polnische Naturidylle Ende der 30er wechselt sich mit der Schilderung von Grausamkeiten gegen die örtlichen Juden ab, mit derselben Detailgenauigkeit und Empathie. Unterbrochen werden diese Beschreibungen durch die Briefe der gänzlich dummen und albernen Verlobten von Wilms, die damals gerade in Italien mehrmonatige Ferien mir ihren Eltern machte.
So bitter und ernst aber ist keine der nachfolgenden Geschichten mehr. Immer wieder kehren wir in den Jockey-Club zurück, zu weiteren „Lagen“ White Lady, Henkell trocken, Canadian, Weinbrand. Mit der Stimmung werden auch die Erzählungen heiterer. Fühlte ich mich zunächst an Platons Gastmahl erinnert, entwickelt sich der Abend mehr und mehr zum Dekameron und zu den Canterbury Tales. Wir hören unter anderem von einem deutschen General stationiert in Norwegen an der Grenze zu Finnland (Offizierskasino-Rituale, Freiheitskämpfer, Jagdszenen, väterliche Toleranz), von einer schönen, klugen Frau mit aufregender internationaler Geschichte und ihrer unglücklichen jugendlichen Liebe, vom Besuch des Erzählers beim gemeinsamen Freund Koslowski in der Ostzone wenige Jahre nach dem Krieg, Historisches von den Vorfahren der schönen klugen Frau im 18. Jahrhundert, von der Suche nach einem Gefallenengrab in Kowslowskis Wohnort, und zuletzt – in den frühen Morgenstunden, als die Gesellschaft bereits bei Prärieaustern angekommen ist – eine wilde und platterotische Schelmengeschichte aus einer italienischen Pension.
Die Erzähltechniken unterscheiden sich deutlich, schließlich handelt es sich mal um handschriftliche Aufzeichnungen eines Frontsoldaten, mal um ein Drehbuch-Exposé, mal um Erinnerungen, mal um Fiktion. Die Szenen im Jockey-Club selbst sind meist reine Dialoge, aus denen sich die Handlung indirekt erschließt. Gerade diese Passagen nahmen mich mit in eine vergangene, aber sehr lebendige Welt: Nach Westberlin zwischen Kriegsende und Mauerbau. Die Menschen sind vom Krieg gezeichnet, manche körperlich (Koslowski hat ein Bein verloren, der vorbeischneiende Pianist ein Auge), jeder aber seelisch. Das Wirtschaftswunder ist eindeutig bereits ausgebrochen, doch daran partizipieren beileibe nicht alle.
Am fremdesten und gleichzeitig lebendigsten aber ist die Sprache: Hier spricht eine Generation im ihr ureigenen Jargon – und den bringt niemand zurück, auch nicht ein Guido Knopp, dessen Interviewpartner nur durch den Filter vieler Jahrzehnte erzählen können. Regelmäßig fallen lateinische Zitate, mit fortschreitender Alkoholisierung werden es immer häufiger altgriechische. Sprüche und Ansichten aus der Kaiserzeit werden durch den Kakao gezogen, in den Barszenen schlagen links und rechts One-Liner ein. Ein paar davon habe ich während der Lektüre live getwittert.



![]()


![]()
Am grünen Strand der Spree ist der einzige Roman, den der emsige Kunsthistoriker und Feuilletonist Hans Scholz veröffentlicht hat. Wie meinte der SZ-Laudator sinngemäß: Damit hatte er wohl alles gesagt, was er dazu zu sagen hatte.


 Es gibt Themen im Leben, die immer wiederkehren. Jeder Mensch hat sie, ob heimlich oder offiziell. Es gibt diese Knackpunkte, auf die trifft man in regelmäßigen Abständen und kaut aufs Neue darauf herum. Eines meiner Themen ist die Frage danach, wie Kinder durch das Leben ihrer Eltern beeinflusst werden. Das ist nicht besonders originell, damit beschäftigen sich Wissenschaftszweige der unterschiedlichsten Art und die Literatur sowieso.
Es gibt Themen im Leben, die immer wiederkehren. Jeder Mensch hat sie, ob heimlich oder offiziell. Es gibt diese Knackpunkte, auf die trifft man in regelmäßigen Abständen und kaut aufs Neue darauf herum. Eines meiner Themen ist die Frage danach, wie Kinder durch das Leben ihrer Eltern beeinflusst werden. Das ist nicht besonders originell, damit beschäftigen sich Wissenschaftszweige der unterschiedlichsten Art und die Literatur sowieso.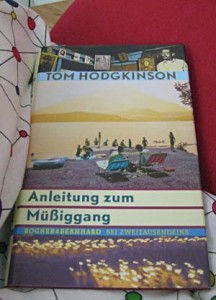 Diese elende Welt ist eingeteilt in Leistungsträger und Minderleister, in Sieger und Versager also, in Schwätzer und Schweiger nicht zuletzt. So zumindest scheint es mir in letzter Zeit. Zudem verkommt das Buchstabengepixel im Internet, genau wie auch Edelgedrucktes auf Papier, mehr und mehr zu einer doch recht armseligen Meinungsverkündigung. ICHICHICH, in enge Schleifen gelegt, schließlich muss alles nicht nur einmal, sondern am besten gleich hundertfach irgendwo verewigt sein. Und zwar einzig und allein, weil man es angeblich jetzt endlich wieder darf. Was auch immer damit gemeint sein mag.
Diese elende Welt ist eingeteilt in Leistungsträger und Minderleister, in Sieger und Versager also, in Schwätzer und Schweiger nicht zuletzt. So zumindest scheint es mir in letzter Zeit. Zudem verkommt das Buchstabengepixel im Internet, genau wie auch Edelgedrucktes auf Papier, mehr und mehr zu einer doch recht armseligen Meinungsverkündigung. ICHICHICH, in enge Schleifen gelegt, schließlich muss alles nicht nur einmal, sondern am besten gleich hundertfach irgendwo verewigt sein. Und zwar einzig und allein, weil man es angeblich jetzt endlich wieder darf. Was auch immer damit gemeint sein mag.