Im Herzen des Schreckens
19. December 2010 | von Anselm Neft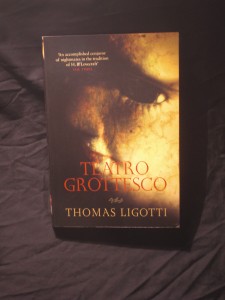 Thomas Ligotti: Teatro Grotesco (Virgin Books 2008)
Thomas Ligotti: Teatro Grotesco (Virgin Books 2008)
Hätten mich alle Geschichten des hier zu besprechenden Buches so fasziniert wie die erste („Purity“) und die letzte („The Shadow, the Darkness“) – ich hätte keine Rezension dazu veröffentlicht. Das, was für mich auf eine eng mit meiner Person verwobene Weise großartig ist, möchte ich nur mit den Wenigsten teilen. Vielleicht ist das egoistisch, vor allem aber verbirgt sich dahinter die Sorge, dass unter den Augen Anderer die Magie geschwächt wird.
Ligotti wollte nach eigener Aussage stets nur ein Insider-Autor sein, und wenn man sieht, dass sein nicht mehr verlegtes Frühwerk hei Amazon für bis zu 200 € gehandelt wird, kann man vermuten: Es ist ihm gelungen.
Wie bei H.P. Lovecraft haben Ligottis Horrorerzählungen einen pessimistischen Überbau. Das Entsetzen ist nicht allein Reaktion auf singuläre Phänomene, sondern in letzter Konsequenz auf die Existenz selbst. Wer dieser “dunklen Gnosis” einmal teilhaftig geworden ist, kann, wenn überhaupt, nur noch durch ein Eingeständnis der Sinnlosigkeit und vielleicht eine zunehmende Identifikation mit dem Gräßlichen in der Monstrosität des Daseins ausharren. Hierzu ein Zitat aus den Erzählfragmenten „Sideshow and other stories“:
“I wanted to believe that this artist had escaped the dreams and demons of all sentiment in order to explore the foul and crummy delights of a universe where everything had been reduced to three stark principles: first, that there was nowhere for you to go; second, that there was nothing for you to do; and third, that there was no one for you to know. Of course, I knew that this view was an illusion like any other, but it was also one that had sustained me so long and so well — as long and as well as any other illusion and perhaps longer, perhaps better.”
In der Titelgeschichte heißt es: “It has always seemed to me that my existence consisted purely and exclusively of nothing but the most outrageous nonsense.”
Ähnlich wie Edgar Allan Poe nähert sich Ligotti der zersetzenden Einsicht in den Widersinn der eigenen Identität und die Widerwärtigkeit des Universums oft mit nüchterner Beobachtung und scheinbarer Rationalität. Auch der größte Irrwitz (wie z.B. die Fabrik in „The Red Tower“) wird mit einer gewissen Gelassenheit dargestellt: Vor dem Unausweichlichen erscheint jede Hysterie unangebracht.
Im Genre des Horrors gehört Ligotti zu den großen Stilisten. In seinen Mitteln limitierter als Poe, übertrifft er sprachlich Lovecraft mit Leichtigkeit. Dennoch neigt auch Ligotti in manchen Passagen zu einem lovecraftschen „Zuviel“. Zwar weiß er sich bei dem Gebrauch von Adjektiven auf das Nötige zu beschränken, aber beizeiten wiederholt er Gedankengänge und leicht variierte Beschreibungen recht häufig, ohne dass jedes Mal die vermutlich angestrebte Sogwirkung (im Sinne eines Thomas Bernhard, der neben Nabokov, Poe und Kafka zu Ligottis Vorbildern zählt) erreicht würde. Obendrein philosophieren die Ich-Erzähler (z.B. in der größtenteils fesselnden Geschichte „The Gas Station Carnivals“) hin und wieder etwas zu ungezügelt vor sich hin und schwächen damit leider die Wirkung der meist atmosphärisch äußerst dichten Erzählungen.
Neben seinem stilistischen Anspruch sowie seinem konsequenten und unbestechlichen Pessimismus, liegt eine weitere Stärke Ligottis darin, dass er moderne Arbeitsbedingungen thematisiert. Texte wie „My Case for Retributive Action” oder „Our Temporary Supervisor“ könnten mit dem Sub-Genre-Etikett “Corporate Horror” versehen werden. Auch die wiederkehrenden Darstellungen von Zirkeln erfolgloser Künsterlerinnen und Künstler bergen einen subtilen schwarzen Humor, der zusammen mit der gotischen Eleganz der ligottischen Phantasmagorien, deren inhaltliche Finsternis erträglich macht. Oder, um es mit Ligotti selbst zu sagen: „We may hide from horror only in the heart of horror.”
P.S.: Die Übersetzungen ins Deutsche sollen nicht besonders gelungen sein.

 So, wie es seelentötenden Volksschlager und herzerfrischende Volksmusik gibt, so finden sich neben abgeschmackten Heimat-romanen auch kraftstrotzende. ”Philomena Ellenhub” reiht sich unter die letztgenannten. Der 1937 erschienene „Salzburger Bauernroman“ wurde zwar vor Drucklegung vom Zsolnay-Verlag behutsam von über 1000 auf etwa 500 Seiten gekürzt, verströmt aber immer noch eine Gemächlichkeit, die effizienzoptimierende Lebenszeitnutzer auf eine harte Probe stellt. Das ahnen Leserin wie Leser bereits beim Eröffnungssatz: „Die Landschaft, worin unsere Erzählung wurzelt, bildet ein Tal, flankiert von Wäldern, fast noch so dicht wie in den Zeiten, wo Hirsch und Eber darin hausten, und von Höhen bis über tausend Meter; doch weil das Gebirge dahinter Felsen aufweist, bis zu zwei- und dreitausend, nennt man es das „Flachland“. Hier wächst die Protagonistin in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts heran. Zu Beginn des Romans ist Philomena aus dem stolzen Bauerngeschlecht der Ellenhuber zwölf Jahre alt. Die Eltern sterben und sie und ihre Geschwister werden auf unterschiedliche Höfe und Handwerksbetriebe verteilt. Mena arbeitet sich beim protzigen Haginghofer und der strengen Haginghoferin vom „Kleinmensch“ zur „Kleindirn“ herauf. Sie muss sich gegen Gehässigkeiten und Zudringlichkeiten erwehren, findet unter dem Gesinde Freunde, empfängt nachts am Fenster ihres Zimmers Liebhaber, bekommt ein Kind, muss es als Unverheiratete zur „Kinderkathl“ geben und sich nach einer neuen Stelle umsehen. Erst arbeitet sie beim schrulligen Ehepaar Kröll, dann beim gewitzten „Butterkönig“.
So, wie es seelentötenden Volksschlager und herzerfrischende Volksmusik gibt, so finden sich neben abgeschmackten Heimat-romanen auch kraftstrotzende. ”Philomena Ellenhub” reiht sich unter die letztgenannten. Der 1937 erschienene „Salzburger Bauernroman“ wurde zwar vor Drucklegung vom Zsolnay-Verlag behutsam von über 1000 auf etwa 500 Seiten gekürzt, verströmt aber immer noch eine Gemächlichkeit, die effizienzoptimierende Lebenszeitnutzer auf eine harte Probe stellt. Das ahnen Leserin wie Leser bereits beim Eröffnungssatz: „Die Landschaft, worin unsere Erzählung wurzelt, bildet ein Tal, flankiert von Wäldern, fast noch so dicht wie in den Zeiten, wo Hirsch und Eber darin hausten, und von Höhen bis über tausend Meter; doch weil das Gebirge dahinter Felsen aufweist, bis zu zwei- und dreitausend, nennt man es das „Flachland“. Hier wächst die Protagonistin in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts heran. Zu Beginn des Romans ist Philomena aus dem stolzen Bauerngeschlecht der Ellenhuber zwölf Jahre alt. Die Eltern sterben und sie und ihre Geschwister werden auf unterschiedliche Höfe und Handwerksbetriebe verteilt. Mena arbeitet sich beim protzigen Haginghofer und der strengen Haginghoferin vom „Kleinmensch“ zur „Kleindirn“ herauf. Sie muss sich gegen Gehässigkeiten und Zudringlichkeiten erwehren, findet unter dem Gesinde Freunde, empfängt nachts am Fenster ihres Zimmers Liebhaber, bekommt ein Kind, muss es als Unverheiratete zur „Kinderkathl“ geben und sich nach einer neuen Stelle umsehen. Erst arbeitet sie beim schrulligen Ehepaar Kröll, dann beim gewitzten „Butterkönig“.