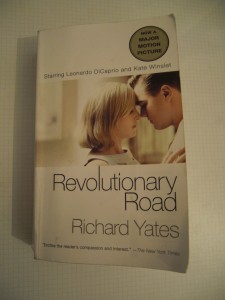Die Leiden des jungen Werktätigen
27. June 2011 | von Anselm Neft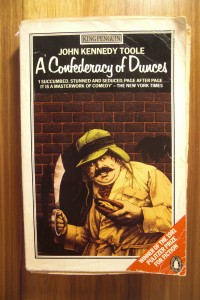 John Kennedy Toole: A Confederacy of Dunces (Penguin Books 1983)
John Kennedy Toole: A Confederacy of Dunces (Penguin Books 1983)
Er ist über dreißig und wohnt bei seiner Mutter. Sein Zimmer ist ein Schweinestall, sein Körperumfang und seine Fresslust eine überambitionierte Hommage an Thomas von Aquin. Er donnert in wallenden Flanellhosen und mit einer grünen Jägermütze durch das New Orleans der 60er Jahre und er hasst die Moderne, wobei er den Begriff „Moderne“ weit fast: Mindestens bis in die Renaissance. Er verachtet Protestanten, die Psychoanalyse, Lohnarbeit, Homosexuelle, fremde Völker, Heterosexuelle, das eigene Volk, das Kino, das Fernsehen, die Werbung und sowieso beinahe alles und jeden. Sein von deftiger, hekatombenweise vertilgter Speise strapazierter Pylorus verschließt sich periodisch, seiner Diagnose zufolge als Antwort auf einen entsetzlichen Mangel an „proper geometry and theology in the modern world“, nur um sich dann als Schleuse für gewaltige Winde zu öffnen: Ignatius J. Reilly – eine Ein-Mann-Armee gegen alles, was sein gottgegebenes Recht auf Ruhe, Müßiggang, Feingeistertum, Kauzigkeit und Völlerei streitig macht.
Wer einen solchen Typen einfach nur doof, langweilig und ekelhaft findet, wird an dem Anfang der 1960er Jahre vollendeten Buch vermutlich wenig Freude haben. Auch sollen bitte solche Literaturfachleute ihre Finger von dem Roman lassen, die U und E so trefflich zu scheiden wissen und Humor für ein Kennzeichen des Trivialen halten, zumal wenn er sich nicht darauf beschränkt „so fein- wie hintersinnig“ zum „Schmunzeln einzuladen aber zugleich nachdenklich zu stimmen“.
Alle anderen sollten zugreifen: Einen derart saftigen Protagonisten in einer derart hanebüchenen und lebensprallen Story bekommt man nur ganz selten geboten. Ignaz J. Reilly verhält sich zu Anti-Helden wie dem Herrn Lehmann oder den Ich-Erzählern der geschätzten Herren Strunk und Schamoni wie eine den Klimawandel herbei flatulierende Büffelherde zu den lauen Lüftchen aus dem Gesäß eines farblosen Molches.
Der Ärger für Ignaz beginnt, als seine besoffene Mutter ihr Auto gegen eine Veranda fährt: 1020 Dollar Schaden. Die Witwenrente reicht nicht: Ignatius muss – trotz fulminanter Proteste – arbeiten gehen. Er verdingt sich als Angestellter bei „Hosen-Levy“, zettelt aus purem Eigennutz einen Aufstand der schwarzen Arbeiter an, findet sich als Würstchenverkäufer im Piratenkostüm wieder, versucht eine subversive Schwulenpartei für seine Zwecke zu nutzen und landet über den Handel mit pornografischen Bildern im Rotlichtmilieu, wo ihn der winidge Wachmann Angelo Mancuso belauert. Nebenbei versucht er ein Standardwerk über „Die Leiden der jungen Werktätigen“ zu verfassen, liest in den fünf Büchern „de consolatione philosophicae“ seines geschätzten Boethius’ – jenem spätantiken römischen Philosophen und zu Unrecht in einer korrupten römischen Zivilisation verurteilten Christen – und schreibt sich pompöse Briefe mit einer ehemaligen Kommilitonin. Myrna Minkoff (er nennt sie meist „the minx“) scheint das genaue Gegenteil von Ignaz: weltoffen, liberal, feministisch und Beatnik in New York City. Sie konfrontiert ihn mit psychoanalytischen Interpretationen seiner ödipalen Sexualneurose, er bezichtigt sie der Blasphemie und einer dem Zeitgeist geschuldeten Verblödung. Es ist jedoch nicht zu überlesen, dass die beiden sich gegenseitig in ihren Briefen zu beeindrucken und gerade durch das Mittel der Provokation näher kennen zu lernen versuchen. Ihr tatsächliches Wiedersehen ist zugleich komischer und tragischer Höhepunkt dieser menippeischen Satire.
Neben dem wundervollen Protagonisten und seinen aberwitzigen Konflikten mit Mutter, Minx und Markt liegt der völlig eigenständige Zauber dieses Romans in den vielen durchaus überzeichneten, aber liebevoll und bis in den Dialekt hinein facettenreich dargestellten Charakteren sowie in einer intensiven und detailreichen literarischen Begehung von New Orleans in den Swinging Sixties.
Toole schrieb zwei Bücher in seinem Leben: The Neon Bible im Alter von 16, A Confederacy of Dunces im Alter von 26. Jahrelang wollte kein Verlag die Geschichte um den wilden Ignaz veröffentlichen. Toole erkrankte an Depressionen und Paranoia. Im Alter von 31 Jahren reiste er zum Haus der verstorbenen Autorin Flannery O’ Connor, deren Southern Gothic Fiction er sehr verehrte. Danach tötete er sich durch Autoabgase.
1980 gelang es Thelma Toole, seiner Mutter, das Buch durch Walker Percy in dem kleinen Wissenschaftsverlag Lousiana State University Press veröffentlichen zu lassen. Ein Jahr später gewann es den Pulitzer Preis und wurde ein in 18 Sprachen übersetzter Millionen-Erfolg.