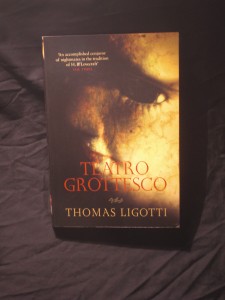Am Schnürchen
27. December 2010 | von ModesteMartin Mosebach, Was davor geschah
 Es existiert eine merkwürdige literarische Konvention, menschliche Erlebnisse nur dann für erzählenswert zu halten, wenn sie Personen zustoßen, die sich am äußersten, gefährdeten Rande der Gesellschaft bewegen. Eine Liebesgeschichte zwischen Obdachlosen etwa, ein wenig Sozialrealismus aus dem Arbeitsamt, ungelüftete Zimmer und die Polizei, ganz als würde der lesende Bürger sich und seiner Welt weder Komödie noch Drama zutrauen. Es mag (aber vielleicht irre ich mich) auch ein wenig einfacher sein, über Menschen zu schreiben, die der durchschnittliche Leser, wie man ihn bei Buchhandlungslesungen oder im Theater antrifft, nicht recht kennt. Man merkt dann nicht gleich, wenn die Abbildung der Gegenwart nicht so arg gelungen sein sollte
Es existiert eine merkwürdige literarische Konvention, menschliche Erlebnisse nur dann für erzählenswert zu halten, wenn sie Personen zustoßen, die sich am äußersten, gefährdeten Rande der Gesellschaft bewegen. Eine Liebesgeschichte zwischen Obdachlosen etwa, ein wenig Sozialrealismus aus dem Arbeitsamt, ungelüftete Zimmer und die Polizei, ganz als würde der lesende Bürger sich und seiner Welt weder Komödie noch Drama zutrauen. Es mag (aber vielleicht irre ich mich) auch ein wenig einfacher sein, über Menschen zu schreiben, die der durchschnittliche Leser, wie man ihn bei Buchhandlungslesungen oder im Theater antrifft, nicht recht kennt. Man merkt dann nicht gleich, wenn die Abbildung der Gegenwart nicht so arg gelungen sein sollte
Spielt eine Liebesgeschichte – nein: deren Vorgeschichte – also einmal unter Menschen, die, ohne direkt gleich im engeren Sinne reich zu sein, wenig finanzielle Sorgen haben, ein offenes Haus im Taunus führen, Gäste in diesem Hause sind, Geschäfte machen und etwas gelangweilt, aber höflich miteinander verheiratet sind, ist man daher angenehm überrascht. Das bürgerliche Liebesleben kommt ja ansonsten immer etwas schlecht weg, so als sei der Spitzensteuersatz zwingend mit erotischer Unerlöstheit verbunden, so dass man schon fast dankbar ist, wenn abseits der ganz trivialen Sphären auch einmal ein Minister a. D. auftritt, ein Unsympath letztlich, aber auch wiederum nicht so verzeichnet, dass er nur noch als Karikatur daherkäme. Auch die Kindergeneration, Leute also zwischen 20 und 30, tauchen auf, die träge, stets etwas benommene Silvi, verheiratet mit dem hoffnungslosen Sohn Hans-Jörg des ehemaligen Ministers, der levantinische Geschäftsmann Salam, das Ehepaar Hopsten und seine Kinder und Gäste, unter ihnen auch der Ich-Erzähler, ein junger Bankangestellter, neu in Frankfurt am Main, und Frau Helga Stolzier, die als eine Art Stilberaterin der Frau Hopsten auftritt, schließlich diejenige Frau einführt, die am Ende den Bankangestellten fragen wird, was denn nun wirklich geschah, bevor man zusammengekommen ist. Viele Zufälle, unspektakulär für sich genommen, kleine, amüsante, sommerliche Geschichten reihen sich wie die Perlen einer Kette aneinander, bis am Ende das Paar sich trifft.
Nahtlos gefügt wie an unsichtbaren Schnüren wechseln die Szenen in angenehm plätscherndem Parlando. Man verliebt sich nicht über Gebühr heftig, man lädt sich ein, man betrügt sich nicht ganz ohne Drama, ein anonym böser Brief trifft ins Schwarze. Am Ende trennen sich zwei Paare, damit sich eins findet, und wenn der Roman endet, hat die Nachtigall gesungen, ein Kakadu hat sich geputzt, ein Baum wurde gefällt, und ganz bar der schrillen Töne fällt der Vorhang unter verdientem Applaus.