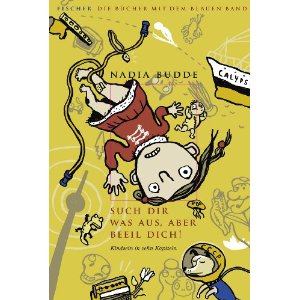Georg M. Oswald, Vom Geist der Gesetze, 2007
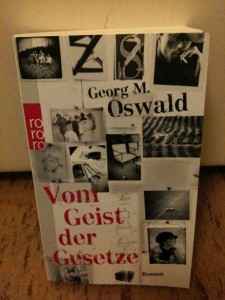
Vor einem runden Dutzend Jahre saß ich – ein wenig gelangweilt, nehme ich an – in einem fensterlosen Hörsaal, und einige Meter vor mir lief ein älterer Herr in beuteligen Hosen hin und her und sprach über das Strafrecht, genauer gesagt: über die soziologische Komponente des Strafens und Bestraftwerdens. Was er ganz genau sagte, habe ich vergessen, aber sinngemäß und sehr ungefähr entnahm ich seinen Worten, dass wir alle Sünder seien, und die Armen, die Ungebildeten und die Ausländer säßen nur deswegen mehr im Gefängnis als andere Leute, weil sie weder am Erlass der Gesetze noch an deren Vollzug beteiligt seien.
Soweit ich mich erinnere, reagierte das Auditorium ungefähr so stumpf, wie es halt zu gehen pflegt, wenn jemand Dinge erzählt, die jeder weiß, und die Empörung des schon damals grauhaarigen Dozenten verpuffte ebenso wirkungslos in der abgestandenen Luft des Juridicums wie – zumindest nehme ich das an – sein Appell, sich stets daran zu erinnern, dass Juristen oft nicht Gerechtigkeit exekutieren, sondern die Summe der Vorurteile der herrschenden gesellschaftlichen Gruppen.
Ein paar Jahre später, ich hatte die Uni inzwischen verlassen, wurde mit diesem Dozenten eine ganze Generation emeritiert, deren stets reizbare Empörbarkeit meistens berechtigt gewesen sein mag, um sich trotzdem bisweilen schmerzhaft lächerlich zu äußern, und dass der Roman des Münchners Georg M. Oswald rein thematisch zumindest einen Hund wie mich nicht hinter dem Ofen hervorzulocken vermag, wird wohl auch damit zu tun haben, dass die Ungerechtigkeit auch in meinen Augen ein Übel darstellt, keine Frage, allerdings ein Übel, über das ich mich eher etwas seltener errege, und das öffentlich auszustellen jedenfalls kein Zweck ist, der das Mittel eines ansonsten eher etwas faden Buches zu heiligen vermag. Die Dinge – und die Anfechtbarkeit dieses Gleichmuts ist mir bewusst – sind, wie sie sind. In Oswalds Buch sind sie also folgendermaßen:
Ein junger Mann mit problematischem Elternhaus und schlechten Examen bekommt, wie es halt so zu gehen pflegt, wegen der Beziehungen seines Onkels einen guten Job bei einem renommierten, eitlen, alten Strafverteidiger. Ein Politiker von durchaus mittelmäßigen Gaben möchte hoch hinaus, fährt in einem nicht namentlich genannten, aber recht gut erkennbaren München einen erfolglosen Drehbuchautor an und befiehlt seinem Fahrer, sodann dem Opfer Geld zuzustecken, damit nichts aufkommt, und sich dann als Täter verurteilen zu lassen, damit des Politikers Weste weiß bleibt. Der eitle, alte Strafverteidiger soll den Fahrer verteidigen.
Kompliziert wird es, als der Fahrer in der mündlichen Verhandlung nicht mitspielt. Ein eifriger, wenn auch schon etwas resignierter Staatsanwalt nutzt diese Chance, dem Politiker am Zeug zu flicken, der alte Anwalt schläft mit der Freundin des Anfängers, den sich wiederum die junge Frau des Alten nimmt, es tauchen viele, viele politische und private Affären und –affärchen auf und dienen dem weiteren Fortgang der Handlung als manchmal etwas sehr zurechtgebaute Treppen und Flure zwischen den einzelnen Akten der Handlung, und dass am Ende nicht das Gute – wer auch immer das sein mag – gewinnt, weiß man auf den ersten Seiten des Buches, denn andernfalls ginge die Absicht Oswalds nicht auf, mit den Mitteln des satirischen Romans die Verdorbenheit der deutschen Gesellschaft zu demonstrieren. Ein bisschen vorhersehbar ist das alles, und ein wenig bieder dazu. Man gähnt. Ich habe zwischendurch mehrmals um ein Haar nicht weitergelesen:
Zunächst ist die Handlung nicht so besonders originell. Zugegeben, es gibt kaum etwas, das moralische Verkommenheit plakativer demonstriert als der Versuch, die Justiz zu manipulieren, aber ein Autounfall als Auslöser des Zusammenpralls sehr verschiedener Milieus in einem urbanen Biotop ist seit Tom Wolfe sicher nur noch mit Vorsicht zu aufzugreifen. Dass die angeblichen Verflechtungen zwischen den Personen über das selbst im eng vermaschten Hauptstadtbetrieb bekannte Maß doch einigermaßen deutlich hinausgehen, mag als satirische Überzeichnung noch angehen, doch das die Personen das Klischee kaum jemals überragen, verzeiht man dann auch einem flüssig und bisweilen amüsant erzählten Roman nicht. Oswald, so gewinnt man den Eindruck, interessiert sich für die einzelnen Protagonisten seines Buches kaum, die damit mehr als Prototypen denn als Individuen durch die Handlung spazieren. Entsprechend fällt es auch dem Leser nicht ganz leicht, sich für diese Leute zu interessieren. Dass der Roman sprachlich nicht so besonders ausgefeilt ist, mag dagegen auch dem Genre geschuldet sein.
Da hilft es dann auch am Ende nicht viel, dass die (sicher nicht selten zutreffenden) Klischees rund und ordentlich bedient werden. Die Personen sprechen meistens miteinander, wie echte Menschen es zu tun pflegen, und der Roman spielt – was ich meistens und auch hier sehr schätze – nicht im Niemandsland des Innenlebens irgendwelcher Freaks, sondern im realen Raum von Familien, Parteien, Berufen, Strafgerichten, Hotels, Büros und Vinotheken. Vielleicht muss das reichen. Es ist selten genug, aber ein gutes Buch, ein gutes Buch hat Georg M. Oswald nicht geschrieben.
 Der Roman beginnt so: Der Brief in seiner Hand war wie üblich nicht für ihn. Herr Jensen strich mit dem Umschlag knapp unterhalb der Schlitze über die Türen der Briefkästen, so dass sich das vordere Drittel des Umschlags an die Metallgehäuse drückte. An jeder Lücke zwischen zwei Kästen gab es einen kleinen Sprung, und das Adressfeld schien vor seinen Augen leicht zu tanzen.
Der Roman beginnt so: Der Brief in seiner Hand war wie üblich nicht für ihn. Herr Jensen strich mit dem Umschlag knapp unterhalb der Schlitze über die Türen der Briefkästen, so dass sich das vordere Drittel des Umschlags an die Metallgehäuse drückte. An jeder Lücke zwischen zwei Kästen gab es einen kleinen Sprung, und das Adressfeld schien vor seinen Augen leicht zu tanzen.
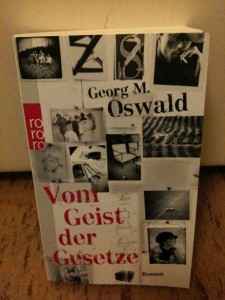
 Der Roman beginnt so:
Der Roman beginnt so: Der Roman fängt so an:
Der Roman fängt so an: Hans-Georg Behr: Fast eine Kindheit (Eichborn, 2002)
Hans-Georg Behr: Fast eine Kindheit (Eichborn, 2002)