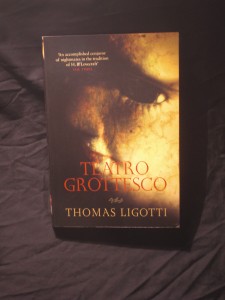Bestürzt
4. September 2012 | von englSturz der Tage in die Nacht, Antje Rávic Strubel
 Ich saufe Bücher derzeit, wie früher nach der Schule, zwei bis drei in der Woche*. Ich komme nicht nach mit den Schreiben hier, mit dem Beschreiben des Lesens. Ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten, hier und da.
Ich saufe Bücher derzeit, wie früher nach der Schule, zwei bis drei in der Woche*. Ich komme nicht nach mit den Schreiben hier, mit dem Beschreiben des Lesens. Ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten, hier und da.
Manche Bücher gehen nahtlos rein, verteilen sich im Körper, im eigenen System, als seien sie dafür gemacht. Andere gehören mir nicht, gehören einfach nicht zu mir. Das muss nicht am Buch liegen, in den meisten Fällen liegt es an mir. Oder am Thema. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht bin, nicht verstehe. Und manche davon erschließen sich auch nicht durchs Lesen. Das ist weder Pech noch Glück, das ist einfach so. Ich kann lesen, wie es ist, über die Kindheit hinaus in einer Familie zu leben. Wie es ist, Menschen zu verlieren, die bislang tagtäglich da waren. Ihre Stimme, ihre Gedanken, ihre Gegenwart. Wirklich verstehen werde ich es wohl dennoch nie. Das weiß ich, und das macht nichts.
Nur wenige Bücher leben dazwischen, zwischen Einverleibung und bleibender Fremdheit. Manche Bücher laden mich ein, verführen mich mit Sprache und Geschick, aber lassen mich dennoch außen vor. Zurückgewiesen, als wäre ich es nicht wert. Sie lassen mich nicht ein, kommen aber auch nicht zu mir. Nicht freiwillig. Diese Bücher lassen mich enttäuscht über die Unmöglichkeit einer Begegnung zurück, nicht gelassen, nicht entspannt. Mit dem Gefühl, etwas Wichtiges nicht erreicht zu haben. Das ist selten, und das ist tragisch. Das sind die Bücher, die ich nicht vergesse, obwohl ich kaum etwas von ihnen weiß.
Mit Büchern von Antje Rávic Strubel habe ich vor Jahren schon diesen Kampf geführt, aussichtslos, gleich zweimal. Gnadenlos bin ich gescheitert, an Offene Blende und Unter Schnee, obwohl ich wirklich alles gegeben habe. Nichts ist geblieben, Fetzen vielleicht, und ich habe aufgegeben. Bis vor ein paar Wochen. Sturz der Tage in die Nacht war unter dieser Vorgabe ohne Zweifel ein Wagnis, das gebe ich zu. Doch es war gnädig. Und ich glücklich. Nach 50 Seiten etwa war die Gewissheit erlangt, dass ich diesmal schaffen könnte, nicht nur meine Augen unverbindlich auf die Worte zu richten, sorgfältig, auf eines nach dem anderen. Sondern mehr von mir, tiefer und weiter, zu sehen, zu wissen, zu verstehen.
Das ist hier kein Rezensionsblog, ich erzähle jetzt nicht, worum es in dem Buch geht. Wozu noch ein Klappentext? Selber lesen macht reich. Oder selber googeln.
400 Seiten sind viel, 400 solche Seiten noch mehr. 437 genau genommen. Zwischendurch laufe ich durch meine Wohnung und klappere ein wenig mit den vorhandenen Steinen, versuche mich in perkussiven Elementen von vor Jahren. Ich lache ein bisschen, besonders über die Dialoge. Ich ärgere mich auch, hier und da. Mal über mich, mal über mich störende Bilder. Was im Grunde dasselbe ist. Fremdheit und Starre, die mich doch fast wieder rauszuwerfen drohen. Es knirscht in den Kurven, Sand auf Metall. Das bin ich. Ich flüchte kopfwärts, wo es nicht angebracht ist. Doch ich spüre eine Zartheit und Intensität, mehr und mehr, die zu mir nicht gehört. Denke ich. Die mich dennoch nicht rauswirft, letztendlich. Diesmal nicht. Die in mich einwächst stattdessen. Dafür ist kein Raum in mir, eigentlich, aber da wird Raum. Vielleicht. Und ich weiß nicht mehr, was ich bin, auf einmal. Das passiert mir sonst nur bei Lyrik.
Am Ende stehe ich da mit einer Frage. Sicher nicht die zentrale Frage dieses Buches, da gibt es andere, eine besonders, das habe ich inzwischen nachgelesen. Doch es ist jetzt mein Buch, ich habe es gekauft. Ich kann damit tun, was sich will. Und die eine bekannte, die scheinbar zentrale Frage interessiert mich eher marginal. Mich dagegen treibt die Frage nach dem Zufall. Kann das wirklich sein, dass all das, diese 437 Seiten, von Anfang an auf der Spitze des Zufalls stehen? Das kann nicht sein, das würde ich mich nie trauen. Ich muss etwas überlesen haben, bei 437 Seiten ein Leichtes. Um einen Zufall zu entkräften, braucht es womöglich nur einen halben Satz. Oder nicht?
Diese offene Frage treibt mich schließlich in eine Lesung. Von Lesungen ist hier sonst nicht die Rede, das soll auch nicht sein. Hier geht es um Bücher und seine Leser, dieses höchst intime Zusammenspiel zweier Giganten. Doch in diesem Fall will ich eine Ausnahme machen, es handelt sich wohl um eine Art Schock.
Lesungen der sogenannten Hochliteratur, die in einem irgendwie postulierten, gar akademischen Rahmen stattfinden, lassen grundsätzlich Schreckliches vermuten. Ich weiß das, ich hätte gewarnt sein sollen. Aber mitunter bin ich ein freches Kerlchen und trage meine olle Fresse auch mal in eine unpassende Umgebung. Wenn es anders nicht geht.
Frontallesung mit Tisch. Gut, das war zu erwarten. Der Raum ist durch und durch beige und wird quer bespielt. Da kann man nichts machen. Ich habe schon auf Europaletten Salsa gespielt, damals, zu Bandzeiten. Die Beine der Trommeln stürzten immer wieder in die Lücken. Aber man nimmt es, wie es kommt. Bei einer Lesung in einem kleinen Theater saß ich einmal über eine Stunde unmittelbar vor einem zirka zwei Meter hohen Eisblock. Selten habe ich so gefroren. Bis heute frage ich mich, ob das Publikum mein unkontrolliertes Zittern gesehehen haben könnte. Das kann man sich nicht aussuchen, das weiß ich. Wenn man auf die Bühne muss. Das Licht kommt an diesem Abend von oben, im ganzen Raum. Und es bleibt, die ganze Zeit. Zwei Strahler sind kaputt, zum Glück auch der über mir. Dafür bin ich dankbar. Die Sitze sind gepolsterte Freischwinger, und es gibt Teppich, natürlich. Nichts, das quietschen oder knarren könnte. So hat der Raum keinen Ton. Ich versuche, ob mein rechter Stiefel vielleicht ein kleines bisschen knatschen mag. Tut er aber nicht. Leider. Ich leide, dabei hat es noch nicht einmal angefangen. Ich schalte mein Mobiltelefon stumm und schreibe eine SMS an Madame Modeste, die mich aus beruflichen Gründen versetzt und in diesem Elend allein gelassen hat. Sie soll auch leiden. Die Luft steht, jetzt schon. Draußen wird es dunkel.
Das alles ist völlig normal, ich weiß. Dennoch bin ich beinah geneigt an dieser Stelle die Lesebühnen zu preisen, deren Gagschnapperei mir sonst doch eher unangenehm ist. Aber Klagenfurt, das ist es. Da, wo sich alles reibt, wenn auch womöglich nur an der Oberfläche. Und außerdem noch zu ganz anderen Themen als nur zu Text und Literatur. Das hat dennoch eine andere Qualität. Das ist gut, das lebt. Klagenfurt ist wirklich einzigartig, das weiß ich in diesem Moment. Dann geht es los.
Ich weiß auch nicht. Sind solche Lesungen eine Leserabtötungsmaschinerie? Soll auf die Art den Büchern der Saft entzogen werden? Die ältere Dame neben mir nickt eindeutig mehrmals ein. Der Text, den ich höre, gefällt mir. Sowieso, den kenne ich ja schon. Aber da ist auch Klang, da ist eine ruhige Kraft. Nichts anderes als das, zumindest nicht in dem, was ich an diesem Abend höre. Trotzdem drückt irgendetwas die Stimmung. Ist es wirklich der Raum? Sind es die Zuhörer, die Veranstalter? Bin ich es? Die „Diskussion“ am Ende bestürzt mich, schlagartig verliere ich die Fassung. Da ist kein Leben mehr, kein Moment, kein Humor. Vorgefertigte Fragen, vom Blatt gelesen, artige Antworten. Doch ja, Frau Strubel müht sich. Vermutlich. Aber wozu? Ich selbst bin augenblicklich eingestaubt. Oder war ich das vorher schon? Mein Hirn ist leer, alle Leselust verloschen. Was war das noch für ein Buch? Ich hatte mich doch hineingelesen, vor nicht allzu langer Zeit. Die Frage nach dem Zufall fällt mir nicht einmal mehr ein. Ich hätte wohl auch nur eine Staubwolke in die Luft gepustet, an diesem stimmlosen, raumlosen Ort. Dann plötzlich Blümchen, Ende, Aus. Kein Wort mehr, kein Satz. Keine Frage. Keine einzige Pause, keine Luft für ein paar Gedanken. Wo doch Literatur auch und vor allem in ihren Leerstellen wohnt, in den Auslassungen und Atempausen.
Diese Lieblosigkeit. Das hat weder dieses Buch, noch die Literatur verdient. Ich hätte da noch eine Frage. Eigentlich. Irgendwo.
Die meisten Zuhörer verschwinden schnell zu den SektWeingläsern. Ich sitze noch da, schreibe eine SMS. Ich will bemitleidet werden, immerhin wurde ich in Literatur erwürgt. In guter Literatur noch dazu, was für eine Verschwendung. Oder wurde in mir die Literatur erwürgt? Ich hoffe nicht. Da beginnen hinter mir zwei Männer, die womöglich zum Haus gehören, ein Fachgespräch. Das erste des Abends, das erste echte, jenseits der schlechten Show. Schreiben kann sie ja, höre ich, aber… In dem Moment höre ich weg, ich mache aus, alles. Das will ich nicht wissen. Ich will Bücher. Ich greife meinen Helm wie zum Schutz und flüchte, so schnell es geht.
Denn Bücher leben. Beim Schreiben, wie ich selber weiß. Und beim Lesen, das ist den meisten Lesern sicher nicht unbekannt. Aber selten in (solchen) Lesungen, fürchte ich. Die machen nur stumm und taub.
So bleibt mir die Frage nach dem Zufall. Offen. Was auch okay ist, denke ich.
* Okay, das war in dieser einen Woche, ich geb’s ja zu. Und das abgebildete Buch gehörte selbstverständlich nicht dazu, das waren kleinere. ;)

 Manchmal werden Bücher persönlich. Das heißt, eigentlich werde sie das bei mir immer, irgendwie, aber nicht immer muss ich etwas dazu sagen. Das wäre zu persönlich, das gehört nur mir. Doch diesmal geht es nicht anders. Ich bitte um Verzeihung.
Manchmal werden Bücher persönlich. Das heißt, eigentlich werde sie das bei mir immer, irgendwie, aber nicht immer muss ich etwas dazu sagen. Das wäre zu persönlich, das gehört nur mir. Doch diesmal geht es nicht anders. Ich bitte um Verzeihung.



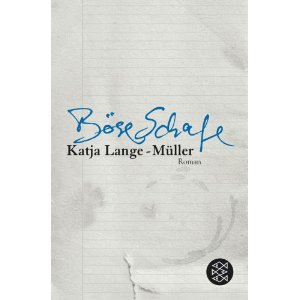
 Es gibt Themen im Leben, die immer wiederkehren. Jeder Mensch hat sie, ob heimlich oder offiziell. Es gibt diese Knackpunkte, auf die trifft man in regelmäßigen Abständen und kaut aufs Neue darauf herum. Eines meiner Themen ist die Frage danach, wie Kinder durch das Leben ihrer Eltern beeinflusst werden. Das ist nicht besonders originell, damit beschäftigen sich Wissenschaftszweige der unterschiedlichsten Art und die Literatur sowieso.
Es gibt Themen im Leben, die immer wiederkehren. Jeder Mensch hat sie, ob heimlich oder offiziell. Es gibt diese Knackpunkte, auf die trifft man in regelmäßigen Abständen und kaut aufs Neue darauf herum. Eines meiner Themen ist die Frage danach, wie Kinder durch das Leben ihrer Eltern beeinflusst werden. Das ist nicht besonders originell, damit beschäftigen sich Wissenschaftszweige der unterschiedlichsten Art und die Literatur sowieso.