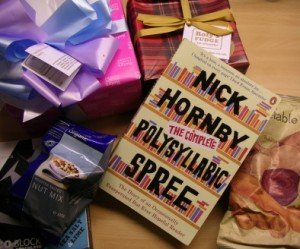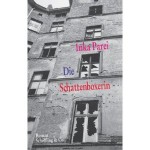Ein anderer Schlag des Herzens
29. August 2010 | von Modeste Irina Liebmann, Wäre es schön? Es wäre schön, 2008
Irina Liebmann, Wäre es schön? Es wäre schön, 2008
Was in der Geschichte des Kommunismus schief gelaufen ist, ist nicht nur unter Historikern vermutlich ein Gegenstand wüster Diskussionen und klaffender Meinungsverschiedenheiten, doch wie auch immer es dazu kommen, dass aus einer berauschenden Vision von Freiheit, Gerechtigkeit und Völkerliebe am Ende nichts wurde als die engherzige, bisweilen lächerliche und in jeder Hinsicht unangemessene Herrschaft einer verlogenen Bürokratie: Fest stehen dürfte, dass die Realität aus FDJ und Plattenbauten die faszinierende, romantische Seite des kommunistischen Projekts so gründlich aus dem Bewusstsein Europas gebrannt hat, dass selbst die Renegatenromane des 20. Jahrhunderts – die Koestler, Sperber et. al. – uns nichts mehr anzugehen scheinen. Der große Traum ist vorbei.
Auf die Frage, warum sich ein brillanter, junger, gut etablierter Journalist Anfang der Dreißiger Jahre, moussierend vor Ehrgeiz und Stolz, nicht nur vom Kommunismus angezogen fühlt, sondern dem Kommunismus auf dem langen Weg vom himmelblauen Traum in die schlecht gelüftete Realität treu bleibt, bietet auch Irina Liebmanns 2008 erschienene Biographie über ihren Vater Rudolf Herrnstadt keine Antwort. Es muss etwas Religiöses gewesen sein, das Liebmann wolkig umschreibt, ohne dass es fassbar würde. Herrnstadt habe die Sowjetunion nicht nur geliebt, sondern habe sich auch zurückgeliebt gefühlt, spekuliert Liebmann, ohne zu erklären, warum es einem normalen Menschen überhaupt etwas bedeuten sollte, ausgerechnet von der Sowjetunion geliebt zu werden.
Überhaupt wird viel spekuliert. Zum einen scheint die Faktenlage rund um diese wirren, blutigen Jahre des zweiten Weltkriegs was Herrnstadt betrifft, nicht die beste zu sein. Zum anderen steht es der Tochter Herrnstadts sicher mehr als anderen Leuten zu, sich einem Toten nicht nur über Archive und Zeitzeugen zu nähern, sondern nicht weniger über Erinnerungen. Hörensagen, vielleicht ein halbverschollenes Gefühl, wie es gewesen sein könnte.
Gut war es nicht. Als Herrnstadt Kommunist wird, ist Stalin schon der blutsaufende Herrscher im Kreml. Die großen Namen der Revolution gehören schon Toten, und der Apparat bestimmt mehr und mehr, ob einer ein guter Kommunist und ehrlicher Kämpfer bleibt oder ausgestoßen wird nach Regeln, die keiner kennt. In Berlin – hier arbeitet Herrnstadt als Journalist des Berliner Tageblatts – wird Hitler schon empfangen, man riecht das kommende, das frische Blut, und als dann soweit ist, emigriert Herrnstadt, gefährdet nicht nur als Kommunist, sondern auch als Jude, nach einem Intermezzo in Warschau nach Moskau.
Viel erfährt man nicht über die Verhältnisse im Moskau der Säuberungen. Wie es war in diesem fleckigen, wirren Alptraum aus Macht und Tod und Angst, zeigt Liebmann uns kaum. Vielleicht ist das nicht ihr Thema, vielleicht gehört das zu der Lebensgeschichte ihres Vaters ihrem Empfinden nach nur am Rande dazu, doch mir scheint, dass man nicht von einem kommunistischen Politiker dieser Jahre erzählen kann, und berichtet über die Beben, die den Boden dieser Welt zerrissen, nur ganz en passant. Es muss die Welt verwandelt haben, stelle ich mir vor.
Vom Nationalkomitee Freies Deutschland erzählt Liebmann, diesem erstaunlichen Versuch, Deutschland nicht nur zu besiegen und zu beherrschen, sondern sein Herz so zu gewinnen, wie es den Amerikanern dann später wirklich gelungen ist und den Russen nie. Von der Rückreise ins zerstörte Berlin, von der Berliner Zeitung und dem Neuen Deutschland, und von einem kranken, immer kränkeren Mann, der sich aus Russland die Tuberkulose mitgebracht hat.
Ihren Höhepunkt erreicht Liebmanns Erzählung rund um den 17. Juni. Die Massen lieben die Herrschaft nicht, lieben sie noch etwas weniger als andere, schweigend ertragene Herrschaft, und lehnen sich auf. Ein paar Tage hält sich die Macht in luftiger Schwebe, doch dann siegt – am Ende entscheiden die Russen – Ulbricht. Herrnstadt, der auf Ulbrichts Ablösung gedrängt hat, verliert alle Posten und wird Archivar in Merseburg. Die Führung der SED schreibt Herrnstadt und einem anderen, verstoßenen Mitglied des Politbüros die Schuld für die Ereignisse rund um den Aufstand zu und geht zur Tagesordnung über. Herrnstadt reist ab.
Etwas Verächtliches liegt in dem verordneten Posten, den Herrnstadt annimmt und ausfüllt und sogar in den Archiven forscht. Kommunist bleibt er. Kommunist zu sein scheint für Herrnstadt nicht von der Frage abzuhängen, ob die kommunistische Herrschaft gut und gerecht ist zu ihm, nicht einmal, ob der Kommunismus gut ist für andere, ob er gut ist für die Arbeiter, die der Kommunismus in seinen Sonntagsreden vergöttlicht, um sie werktäglich so herablassend zu behandeln, wie es einer bürgerlichen Demokratie nicht einfiele, und dann stirbt Rudolf Herrnstadt nicht an der Tuberkulose, sondern am Krebs, und nimmt – mit ihm eine ganze Generation toter Kommunisten – das Rätsel der Attraktion dieser Menschheitskatastrophe mit sich ins Grab.
Etwas hilflos hinterlassen uns daher auch in diesem, nicht sehr bedeutenden und sprachlich oft unzureichenden Buch die Schilderungen der vielen Opfer, der Anstrengungen und der ehrlich empfundenen Gefühle für etwas, das einmal rein gewesen sein mag, und diese Reinheit verloren hat in dem Morast des 20. Jahrhunderts aus Dreck und Blut und Lügen. Liebmann hilft uns nicht weit auf dem Weg zum nachsichtigen Verständnis dieser fremden Toten, aber vielleicht liegt das nicht an den Unzulänglichkeiten dieses Buches. Vielleicht ist es ganz und gar vorbei, und nicht nur der Traum vom Kommunismus, sondern alle Träume vom ganz anderen Leben modern irgendwo in der Erde und kommen nicht wieder, nicht einmal bei Nacht.