Johannes Freumbichler: Philomena Ellenhub.
31. May 2010 | von Anselm Neft So, wie es seelentötenden Volksschlager und herzerfrischende Volksmusik gibt, so finden sich neben abgeschmackten Heimat-romanen auch kraftstrotzende. ”Philomena Ellenhub” reiht sich unter die letztgenannten. Der 1937 erschienene „Salzburger Bauernroman“ wurde zwar vor Drucklegung vom Zsolnay-Verlag behutsam von über 1000 auf etwa 500 Seiten gekürzt, verströmt aber immer noch eine Gemächlichkeit, die effizienzoptimierende Lebenszeitnutzer auf eine harte Probe stellt. Das ahnen Leserin wie Leser bereits beim Eröffnungssatz: „Die Landschaft, worin unsere Erzählung wurzelt, bildet ein Tal, flankiert von Wäldern, fast noch so dicht wie in den Zeiten, wo Hirsch und Eber darin hausten, und von Höhen bis über tausend Meter; doch weil das Gebirge dahinter Felsen aufweist, bis zu zwei- und dreitausend, nennt man es das „Flachland“. Hier wächst die Protagonistin in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts heran. Zu Beginn des Romans ist Philomena aus dem stolzen Bauerngeschlecht der Ellenhuber zwölf Jahre alt. Die Eltern sterben und sie und ihre Geschwister werden auf unterschiedliche Höfe und Handwerksbetriebe verteilt. Mena arbeitet sich beim protzigen Haginghofer und der strengen Haginghoferin vom „Kleinmensch“ zur „Kleindirn“ herauf. Sie muss sich gegen Gehässigkeiten und Zudringlichkeiten erwehren, findet unter dem Gesinde Freunde, empfängt nachts am Fenster ihres Zimmers Liebhaber, bekommt ein Kind, muss es als Unverheiratete zur „Kinderkathl“ geben und sich nach einer neuen Stelle umsehen. Erst arbeitet sie beim schrulligen Ehepaar Kröll, dann beim gewitzten „Butterkönig“.
So, wie es seelentötenden Volksschlager und herzerfrischende Volksmusik gibt, so finden sich neben abgeschmackten Heimat-romanen auch kraftstrotzende. ”Philomena Ellenhub” reiht sich unter die letztgenannten. Der 1937 erschienene „Salzburger Bauernroman“ wurde zwar vor Drucklegung vom Zsolnay-Verlag behutsam von über 1000 auf etwa 500 Seiten gekürzt, verströmt aber immer noch eine Gemächlichkeit, die effizienzoptimierende Lebenszeitnutzer auf eine harte Probe stellt. Das ahnen Leserin wie Leser bereits beim Eröffnungssatz: „Die Landschaft, worin unsere Erzählung wurzelt, bildet ein Tal, flankiert von Wäldern, fast noch so dicht wie in den Zeiten, wo Hirsch und Eber darin hausten, und von Höhen bis über tausend Meter; doch weil das Gebirge dahinter Felsen aufweist, bis zu zwei- und dreitausend, nennt man es das „Flachland“. Hier wächst die Protagonistin in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts heran. Zu Beginn des Romans ist Philomena aus dem stolzen Bauerngeschlecht der Ellenhuber zwölf Jahre alt. Die Eltern sterben und sie und ihre Geschwister werden auf unterschiedliche Höfe und Handwerksbetriebe verteilt. Mena arbeitet sich beim protzigen Haginghofer und der strengen Haginghoferin vom „Kleinmensch“ zur „Kleindirn“ herauf. Sie muss sich gegen Gehässigkeiten und Zudringlichkeiten erwehren, findet unter dem Gesinde Freunde, empfängt nachts am Fenster ihres Zimmers Liebhaber, bekommt ein Kind, muss es als Unverheiratete zur „Kinderkathl“ geben und sich nach einer neuen Stelle umsehen. Erst arbeitet sie beim schrulligen Ehepaar Kröll, dann beim gewitzten „Butterkönig“.
Gen Ende des Buches und vielleicht in der Mitte ihres Lebens kommt Mena zu der Einsicht, dass es „vernünftiger war, weniger am Leben teilzunehmen und es mehr zu beschauen.“ Bis dahin hat sie in der kleinen, abgeschlossenen Welt des Dorfes genug erlebt, um sich viele existenzielle Fragen zu stellen: Sie verliert ihr Kind, ihren Großvater und einige Geschwister an Krankheiten und Krieg. Ihr Geliebter, der Wilderer Toni, verendet an einer Schusswunde in ihrem gar nicht mal kitschigen Beisein. Der Ellenhuber Hof wird versteigert, ein Brand vernichtet große Teile des Dorfes, ein Ausflug nach Wien erweist sich als Ernüchterung: hier sind die Armen viel elender als die Armen im Dorf.
Bei all diesen Krisen bleibt Menas Leben erfüllt von Lebenslust und Vertrauen in einen guten Urgrund aller Dinge. Mena wird als starke Frau gezeichnet, die früh Verantwortung für sich und andere übernimmt, viel nachdenkt und versucht aus Fehlern zu lernen. Die Feste feiert sie, wie sie fallen, und dafür gibt es genug Gelegenheiten: Hochzeiten mit ausufernden Singspielen (das Buch führt etliche Liedtexte, teils in Mundart auf), kirmesartige Vergnügungen, Wiedersehen mit den Geschwistern oder den Wettlauf der Siebziger, in dem ihr geliebter Großvater die anderen Alten des Dorfes besiegt. Dieses Wettlauf-Kapitel zählt zu den vielen eindrücklichen Episoden des Romans. Eine anderes großartiges Kapitel lautet „die Versammlung“ und beschreibt eine politische Debatte in einem Gasthaus am Vorabend der Revolution von 1848. Revolutionäre, Reformer und Konservative liefern sich unter den Zwischenrufen der Bauern und Krämer ein Wortgefecht, das gleichzeitig lebensecht und exemplarisch wirkt und an literarische Großtaten wie Zolas „Germinal“ erinnert. In der Beschreibung des einfachen, harten und doch lustvollen Landlebens zeigen sich bei Freumbichler Parallelen zu Knud Hamsuns „Segen der Erde“. Allerdings ist es kein Wunder, dass Zola und Hamsun bekannter sind als Freumbichler. Zwischen die erstklassigen Passagen mogeln sich immer wieder weitschweifige, verzückte Naturbeschreibungen und betuliche Betrachtungen über Gott und den Lauf der Welt, die entweder Philomena in den Kopf gedichtet, anderen Figuren in den Mund gelegt oder gleich vom allwissenden Erzähler altväterlich zum Besten gegeben werden: „Es gibt keine andere Rettung: du selbst in dir selber, das ist das höchste Geheimnis und eine Kraft ohnegleichen. So geht auch, meines Erachtens, in tief verworrenen Zeiten ein Volk zum Bauerntum zurück, weil es instinktiv fühlt, dass hier der Weg führt zur wahren Weisheit. Ein Hauptstück dieser Weisheit liegt im Gesetz der Sonderung, das, wie alle großen Gesetze, göttlicher Natur ist. Diese Sonderung heißt: Arbeit und Genuss, Ruhe und Bewegung, Werktag und Feiertag, Jugend und Alter, Mann und Weib, Krieg und Frieden.“
Wer nun in Freumbichlers Roman eine beizeiten herzhaft-reaktionäre Sichtweise vermutet, liegt richtig. Die Unterschiede der Stände und der Geschlechter werden zwar nicht durchgängig als naturgegeben wahrgenommen, aber für Freumbichler waltet in allem ein gerechter Weltgeist, der jedem Menschen gleichermaßen Freude und Leid zuteilt, ganz unabhängig von Schicht, Einkommen und Geschlecht. Ein wichtiges Instrument dieses Weltgeistes ist „die Majestät des Todes. Sie war gerecht und traf jeden ohne Unterschied, den Reichsten wie den Ärmsten; sie war mitleidlos, Mitleid verträgt sich nicht mit Gerechtigkeit.“
Die Größe des Romans liegt darin, dass Freumbichler vor allem die Kleinen und Schwachen zu Wort kommen lässt und ihre Sichtweisen ernst nimmt: Kinder, Außenseiter des Dorfes wie den religiösen Halbnarren „Die Ewig-Gerechtigkeit“, das Atheisten-Kind „Schinder-Pelei“, den verarmten Kunstmaler Peregrin, den gesetzlosen Wilderer Toni, die zwielichtigen Brüder „die drei heiligen Schneider“ und natürlich vor allem seine weibliche Hauptfigur, die sehr liebevoll dargestellte Philomena Ellenhub.
Johannes Freumbichler, 1881 in Henndorf geboren, hat in seinen Ausführungen genau dieses österreichische Kaff vor Augen. Als lebenslang erfolgloser und im Ort belächelter Schriftsteller hätte er über die engstirnige Welt der Bauern und kleinen Kaufleute, der Frömmler und selbstherrlichen Gutsbesitzer Gift und Galle spucken können. Tatsächlich lässt er den Kunstmaler einmal über die Dorfbewohner sagen: „Tiere, die von der Macht des Geistes keine Ahnung haben! Aufrecht gehende, dressierte Tiere.“ Genau dieser Maler gibt jedoch sein Leben in einer bizarren Opferung, die das Dorf vor dem weiteren Wüten eines Brandes bewahren soll.
Thomas Bernhard notiert über Freumbichler, seinen Großvater, der sein ganzes Leben dem Schreiben unterordnete, in der autobiographischen Erzählung „Die Ursache“: „Alle meine Kenntnisse sind zurückzuführen auf diesen für mich in allem lebens- und existenzentscheidenden Menschen.” Immer wieder trug sich Bernhard mit der Idee, Freumbichlers Roman, der 1937 den Förderpreis zum Großen Österreichischen Staatspreises und somit immerhin etwas Aufmerksamkeit gewann, erneut heraus zu bringen. Allerdings konnte er sich nie dazu durchringen.
Ignatz Hennetmair, ein Freund von Thomas Bernhard, zitiert den Schriftsteller in seinem Tagebuch „Ein Jahr mit Thomas Bernhard“ mit den Worten: „Beim Weiterlesen habe ich schwache Stellen entdeckt. Alles ist viel zu schön, viel zu schön geschildert. Alles, was ich als scheußlich empfinde, findet mein Großvater schön”.

 Ich bin verdrüßlich!
Ich bin verdrüßlich! Der Roman beginnt so:
Der Roman beginnt so:
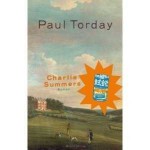 Der Roman beginnt so:
Der Roman beginnt so:
 Es gibt Leute, die die Klagenfurter „Tage der deutschsprachigen Literatur“, vulgo den Bachmannpreis, leben und feiern wie andere Leute (viel, viel mehr Leute) die Fußballweltmeisterschaft – ein mir ausgesprochen sympathisches Spinnertum. Seit 2004 gehört auch Angela Leinen dazu, die ich als Autorin des Blogs
Es gibt Leute, die die Klagenfurter „Tage der deutschsprachigen Literatur“, vulgo den Bachmannpreis, leben und feiern wie andere Leute (viel, viel mehr Leute) die Fußballweltmeisterschaft – ein mir ausgesprochen sympathisches Spinnertum. Seit 2004 gehört auch Angela Leinen dazu, die ich als Autorin des Blogs  Der Roman beginnt so:
Der Roman beginnt so: Die Liebe kommt über Zaimoglus Helden David wie ein Hieb: Verletzt liegt der deutschtürkische ehemalige Banker aus Kiel nach einem Busunglück in der Türkei auf der Straße, als eine junge, schöne Frau mit einem auffälligen Ring erste Hilfe leistet und ihn tränkt. David verliebt sich nicht: David fällt in Liebe.
Die Liebe kommt über Zaimoglus Helden David wie ein Hieb: Verletzt liegt der deutschtürkische ehemalige Banker aus Kiel nach einem Busunglück in der Türkei auf der Straße, als eine junge, schöne Frau mit einem auffälligen Ring erste Hilfe leistet und ihn tränkt. David verliebt sich nicht: David fällt in Liebe.