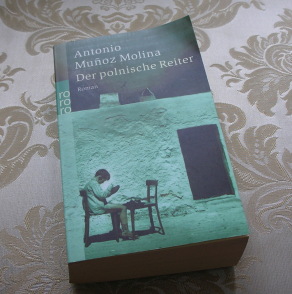
So lange habe ich schon lange an keinem Buch mehr gelesen.
Der polnische Reiter wurde als El jinete polaco von Antonio Muñoz Molina geschrieben und von Willi Zurbrüggen ins Deutsche übersetzt. Von Muñoz Molina hatte ich fürs Studium Beatus Ille gelesen, das hatte mir gut genug gefallen, dass ich mehr von diesem Autor lesen wollte. Bis es tatsächlich dazu kam, vergingen allerdings 15 Jahre.
Antonio Muñoz Molina, Jahrgang 1956, gilt als einer der wenigen literarischen Vergangenheitsverarbeiter Spaniens, einer Nation, die erst jetzt, in der Enkelgeneration, anfängt, sich mit Bürgerkrieg und Franco-Diktatur so richtig auseinander zu setzen. Ich habe mir das immer mit der Natur von Bürgerkriegen erklärt: Die Gräben verliefen 1936 bis 1939 buchstäblich durch die Familien – und das nicht unbedingt aus ideologischen Gründen: Sowohl die eine also auch die andere kriegsführende Partei zog rekrutierend übers Land. Die einen nahmen den einen Bruder mit und ließen ihn für sich schießen, die anderen den anderen. In meiner ohnehin Geschichten-armen spanischen Familie wird sowas angedeutet; geredet wurde über den Bürgerkrieg nie. Die Wunden, die der spanische Bürgerkrieg innerhalb der Gesellschaft geschlagen hatte, waren vielleicht so tief, dass die Leute nach Ende der Franco-Diktatur (die, wohlgemerkt, durch den Tod des Diktators beendet wurde, nicht etwa durch ein politisches Aufbegehren) alle Chancen im Blick nach Vorne sahen und die Vergangenheitsverdrängung der Franco-Jahre begeistert weiterführten. Denn anders als erwartet, sprangen in der neuen Demokratie Spaniens aus den Schubladen von Schriftstellern nicht etwa massenhaft geheim gehaltene, regimekritische Manuskripte – da war nichts. Es dauerte eine ganze Reihe von Jahren, bis die Kunst soweit war, sich des Themas anzunehmen.
Am polnischen Reiter (erschienen 1991) las ich zum einen deshalb so lange, weil es ein sehr dickes Buch ist: 700 Seiten, kleine Schrift, lange Kapitel. Zum anderen aber, weil die Geschichte sehr dicht ist: Sie enthält praktisch keine weitschweifigen Beschreibungen, kein Vor-sich-hin-Gebrabbel, das ich absatzweise überflöge. Der rote Faden des Romans wird geknüpft aus einem Ort und einer Person: Dem fiktiven südspanischen Mágina und Manuel, der nach dem Krieg als Sohn von Feldarbeitern in Mágina aufwächst. Der Roman beginnt mit Liebesszenen zwischen dem erwachsenen Mann Manuel und der etwa gleichaltrigen Nadia; und immer wieder ziehen sie aus einem Koffer in der Wohnung, dem Koffer des örtlichen Fotografen Ramiro Retratista, alte Fotos. In Rückblicken wird die Geschichte einiger der Personen auf diesen Fotos erzählt, doch nie linear, oft personal, oft aus der Perspektive Manuels, manchmal aus auktorialer Perspektive, oft sehr impressionistisch anhand intensiver Sinneseindrücke. Die Sätze scheinen endlos – und bewirken einen tranceartigen Zustand, der dem Versinken in Erinnerungen gleicht, inklusive Assoziationen und Gefühlen. Den Hintergrund dieses Gewebes bildet Spanien zwischen etwa 1930 und der Gegenwart des Buches.
Jede Seite des Romans fesselt mich, wahrscheinlich aus sehr persönlichen Gründen. Das beginnt mit der Sprache. Mein Spanisch ist leider bei Weitem nicht gut genug, dass ich den Roman im Original lesen könnte. Doch habe ich genug Spanien- und Spanischkenntnisse, dass das Original ständig durch die Übersetzung hindurchscheint, vor allem bei eigentlich unübersetzbaren Details. Wenn es von einem sehr alten Mann heißt, er kleckere beim Trinken nie, nicht einmal wenn er „direkt aus dem Krug“ trinke – dann weiß ich eben, dass mit „Krug“ ein porrón gemeint ist, aus dem man das Getränk ohne Berührung direkt in den Mund schüttet (aus dem ich nie anständig trinken konnte, so oft ich als Kind in den Sommerferien auch heimlich hinterm Haus meiner spanischen Yaya übte). Oder das Kohlenbecken unter dem Tisch, von dem ständig die Rede ist: Es handelt sich um einen brasero. Selbst habe ich nie einen im Einsatz erlebt – das mag daran liegen, dass ich bis vor wenigen Jahren nur im Sommer in Spanien war. Aber ich erinnere mich, dass alte Esstische etwa 20 cm über dem Boden ein Brett hatten, deutlich kleiner als die Tischoberfläche, mit einer großen runden Aussparung. Dort hinein, so erzählte man mir, kam im Winter ein metallenes Becken voll glühender Kohle. Über den Tisch wurde eine Decke gelegt, die bis zum Boden reichte; wer es warm haben wollte, setzte sich an den Tisch mit den Beinen unter der Decke. Soweit zur Ingenieurskunst in einem Land, dass durchaus bitterkalte Winter kennt.
Lange Passagen des Romans spielen in einer geradezu archaischen Welt. Die schiere Last der Existenz, die die Menschen durch ein Netz gesellschaftlicher Fesseln erklärbar machen: Armut, aus der man sich nicht zu befreien hat, entsetzlich schwere körperliche Arbeit, die Kinderknochen verbiegt und Männer noch am Abendbrottisch vor Erschöpfung einschlafen lässt. Das ermüdende Ritual des Werbens zwischen den Geschlechtern, in dem jedes Detail so strikt vorgegeben ist wie in der Liturgie einer katholischen Messe. Alle leiden darunter, doch zumindest können sie jederzeit erklären, woraus die Last des Lebens besteht. Von der Mutter Manuels heißt es:
Die Vermutung einer unwillentlich auf sich geladenen Schuld und die Furcht, ohne Erklärung bestraft zu werden, wirkten wie eine unaufhörliche Erpressung auf ihre Seele.
Das komplizierte Verhältnis der Generationen mit seiner Zerrissenheit zwischen Verpflichtung und Freiheitsdrang, Erwachsenwerden im Andalusien der 70er, Freundschaften, die lange Pausen überdauern, Abtrünnigkeit, die sich unter perfekter Stromlinienform verbirgt, die Auswirkungen von Emigration und Flucht auf persönliche Beziehungen – ich bilde mir ein, das vergangene Spanien durch diesen Roman besser zu verstehen.
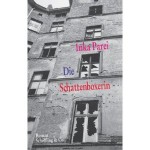 Der Roman beginnt so:
Der Roman beginnt so:
 Der Roman beginnt so:
Der Roman beginnt so: