Judith Schalansky: Atlas der abgelegenen Inseln. Fünfzig Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde
31. January 2010 | von Isa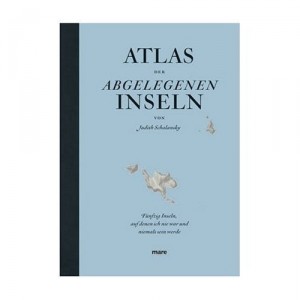
„Das Paradies ist eine Insel. Die Hölle auch.“
Der „Atlas der abgelegenen Inseln“ wurde von der Stiftung Buchkunst zum schönsten Buch des Jahres 2009 gekürt, und wenn die es nicht getan hätte, dann hätte ich es getan.
Judith Schalansky stellt auf jeder Doppelseite eine Insel vor, zumeist solche, von denen man noch nie gehört hat, und auf die man in der Tat niemals gelangen wird. Auf der rechten Seite findet sich jeweils eine Karte der Insel (alle im selben Maßstab) und auf der linken Seite ist der Name der Insel angegeben, teilweise auch mehrere Namen oder Namen in unterschiedlichen Sprachen, ihre Größe, die Einwohnerzahl, darunter auf einem Entfernungsstrahl die Entfernung zum Festland und die zur nächstgelegenen in diesem Buch beschriebenen Insel, und auf einem Zeitstrahl ein paar wichtige Daten.
Und darunter ein Text, etwas mehr als eine halbe Seite, auf der keineswegs die wichtigsten Fakten über die Insel zusammengefasst werden, sondern ziemlich willkürlich ein Punkt herausgegriffen wird. Und das macht einen Teil der Zauberhaftigkeit dieses Buches aus: dass es die Unvollständigkeit zum Stilmittel erhebt und einfach über jede Insel irgendwas erzählt. Das kann ein Schnappschuss von einem historischen Ereignis sein oder die Beschreibung eines Tiers, das es nur dort gibt, oder eine geografische Besonderheit oder die verlassene Wetterstation. Ein Detail.
Der andere Teil der Zauberhaftigkeit dieses Buchs liegt in seiner Ausstattung: das schönste Buch des Jahres 2009 ist ungefähr DIN A 4 groß und von außen blau, mit Leinenrücken und orangefarbenem Schnitt. Innen hat die rechte Seite mit der Insel einen blauen Hintergrund, Landkarten-Meeresblau, die linke hat Text, schwarz auf weiß, mit einigen orangefarbenen Details; die Autorin befasst sich sonst mit Typografie, und das sieht man natürlich. Und als wäre das alles noch nicht genug, riecht das Buch auch noch unglaublich gut.
Man kann wunderbar ein bisschen darin blättern, sich hier und da festlesen, sich an Papier, Duft und Optik erfreuen, nebenbei ein bisschen erratische Bildung mitnehmen und immer wieder zwischendurch ein Loch in die Luft gucken und sich fragen, wie es sein mag, auf einer Insel zu leben, auf der außer einem selbst nur noch drei weitere Menschen wohnen. Oder ob die Verschleppten je zurückkehren durften. Oder ob Dore die Baronin umgebracht hat. Und es möchte einem schier das Herz brechen, dass es tatsächlich eine Insel mit dem Namen Einsamkeit gibt. „Die Einsamkeit liegt im Nordpolarmeer.“
Geht hin und kauft. Für ein so aufwendig und liebevoll gemachtes Buch sind 34,- € nicht mal viel.
Ich weiß noch nicht, an welchen Regalplatz das Buch kommt. Eigentlich möchte ich es gar nicht ins Regal stellen, es soll immer irgendwo herumliegen. Und dann will ich es immer wieder in die Hand nehmen und darin herumlesen. Und daran riechen.



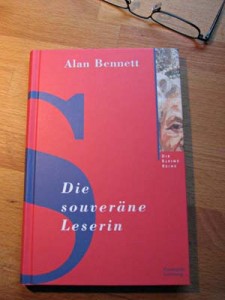 Eines Tages entdeckt
Eines Tages entdeckt 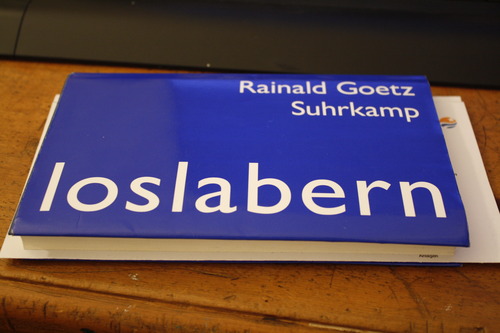 Dann fange ich mal mit dem Buch an, das ich vorhin zugemacht habe: LOSLABERN von Rainald Goetz. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob das Wort auch wirklich groß geschrieben ist, aber so vieles ist mir großgeschrieben hängengeblieben an diesem Buch, wie ja an Rainald Goetz generell. Und überhaupt. Ob der Titel groß- oder kleingeschrieben ist, wird sich gleich beantworten, wenn ich das Foto schieße, um es dem Text voranzusetzen, daher ist es eh egal, aber gut, worum geht es in LOSLABERN. Das Buch ist eine Totalanalyse des Rainald Goetz in seiner Totalgegenwart der Nullerjahre. Der Ansatz ist wirklich der: loszulabern, ein durchgehender Gedankenstrom, fast gebetsmäßig niedergeschrieben, es liest sich als wäre man in eine Stromschnelle geraten und dem ganzen Geschehen der Nullerjahre ausgesetzt, höchst subjektiv, immer aus der Perspektive des Rainald Goetz, der wie ein überdimensionierter Schwamm alles um sich herum aufsaugt und beim Auswringen alles zu interpretieren versteht, Zusammenhänge zu erkennen vermag, immer ein bisschen zu aufgedreht im Ton, immer ein bisschen zu nervös, immer so, als müsste es raus aus ihm, der Text hat etwas entfesseltes an sich, als hätte hier das Hirn darauf gewartet, losgelassen zu werden, um alles drumherum aufzusaugen, wir sitzen beim ihm im Nacken, wie er sich durch die Berliner Republik bewegt, alle haben sie ihren Auftritt: Döpfner, Kracht, Schirrmacher, Tellkamp, Piechl, Diekmann, nur um mal ein paar zu nennen, die mir jetzt auf Anhieb einfielen, aber auch Don Alphonso taucht auf, Andrea Diener, der Don kriegt sogar eine Doppelseite voll des Lobes, wir streifen mit Goetz durch die Frankfurter Buchmesse, hören ihm beim Denken zu, über die einzelnen Persönlichkeiten, denen er begegnet, was ihn mit denen verbindet, was für Blödsinn er gedacht hat, wie er die Gedanken korrigiert, dann wieder eine Vernissage, ein Abendessen, wir immer im Nacken und hören zu beim Erfassen der Gegenwart.
Dann fange ich mal mit dem Buch an, das ich vorhin zugemacht habe: LOSLABERN von Rainald Goetz. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob das Wort auch wirklich groß geschrieben ist, aber so vieles ist mir großgeschrieben hängengeblieben an diesem Buch, wie ja an Rainald Goetz generell. Und überhaupt. Ob der Titel groß- oder kleingeschrieben ist, wird sich gleich beantworten, wenn ich das Foto schieße, um es dem Text voranzusetzen, daher ist es eh egal, aber gut, worum geht es in LOSLABERN. Das Buch ist eine Totalanalyse des Rainald Goetz in seiner Totalgegenwart der Nullerjahre. Der Ansatz ist wirklich der: loszulabern, ein durchgehender Gedankenstrom, fast gebetsmäßig niedergeschrieben, es liest sich als wäre man in eine Stromschnelle geraten und dem ganzen Geschehen der Nullerjahre ausgesetzt, höchst subjektiv, immer aus der Perspektive des Rainald Goetz, der wie ein überdimensionierter Schwamm alles um sich herum aufsaugt und beim Auswringen alles zu interpretieren versteht, Zusammenhänge zu erkennen vermag, immer ein bisschen zu aufgedreht im Ton, immer ein bisschen zu nervös, immer so, als müsste es raus aus ihm, der Text hat etwas entfesseltes an sich, als hätte hier das Hirn darauf gewartet, losgelassen zu werden, um alles drumherum aufzusaugen, wir sitzen beim ihm im Nacken, wie er sich durch die Berliner Republik bewegt, alle haben sie ihren Auftritt: Döpfner, Kracht, Schirrmacher, Tellkamp, Piechl, Diekmann, nur um mal ein paar zu nennen, die mir jetzt auf Anhieb einfielen, aber auch Don Alphonso taucht auf, Andrea Diener, der Don kriegt sogar eine Doppelseite voll des Lobes, wir streifen mit Goetz durch die Frankfurter Buchmesse, hören ihm beim Denken zu, über die einzelnen Persönlichkeiten, denen er begegnet, was ihn mit denen verbindet, was für Blödsinn er gedacht hat, wie er die Gedanken korrigiert, dann wieder eine Vernissage, ein Abendessen, wir immer im Nacken und hören zu beim Erfassen der Gegenwart.