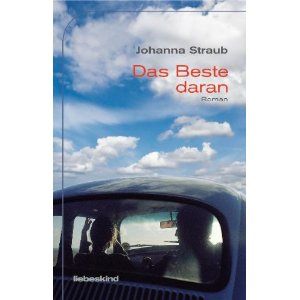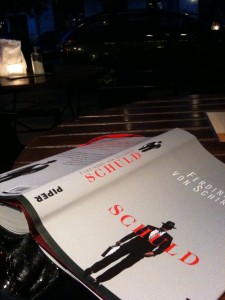Die Einsamkeit der Träumenden
22. September 2010 | von Anselm Neft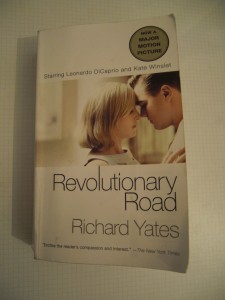 Richard Yates: Revolutionary Road (Vintage Books 2009)
Richard Yates: Revolutionary Road (Vintage Books 2009)
Ach herrlich. Endlich hat einmal alles geklappt: Mir wurde ein Buch empfohlen und ich habe es in Wochenfrist gekauft und dann tatsächlich auch gelesen, ganz, und obendrein so toll gefunden, dass ich dem Empfehlenden schon bald mehrere enthusiastische Mails schreiben musste – und wann passiert so etwas schon einmal?
Das 1961 erschienene „Revolutionary Road“ ist ein echter Knaller. Ein Buch, nach dessen Lektüre ich mich fragte, ob ich tatsächlich weiterschreiben oder den bei anhaltender Erfolglosigkeit auf 40 angesetzten Selbstmord auf dieses Jahr vorziehen soll. Menschen, die nicht selbst schreiben, kann das Buch ebenfalls in Richtung Selbstmord oder zumindest Scheidung bzw. Trennung motivieren. Kurzum: ein großartiges Buch.
Die Geschichte spielt 1955 in einem Vorort von Conneticut, und trotz des Zeit- und Lokalkolorits, haftet dem Geschehen nichts Antiquiertes oder Fernes an. Franklin und April Wheeler sind Anfang 30, haben einen Jungen und ein Mädchen, ein Haus, eine gute Gesundheit und durchaus etwas in der Rübe. Frank arbeitet in New York in einem drögen Bürojob, der ihn weder herausfordert noch ausfüllt. In Phantasien oder Gesprächen mit seinem alkoholkranken Kollegen erhebt er sich Tag für Tag über den Stumpfsinn der Tätigkeit und der Kollegen. April hat sich nur scheinbar in die ihr zugedachte Rolle als repräsentative Gattin, Hausfrau und Mutter gefügt. Sie trauert ihrer abgebrochenen Schauspielerkarriere nach und wagt sogar einen kleinen Neustart in einer lokalen Laienspielgruppe. Mit der Premiere des Stückes „The Petrified Forest“ beginnt der Roman, und es ist kein Zufall, dass wir gleich im ersten Kapitel einer Theateraufführung beiwohnen, die, zumindest was April angeht, vielversprechend beginnt und dann immer bemühter wird. Schließlich gleicht auch das Ehe- und Familienleben der Wheelers zunehmend einer hölzernen Inszenierung. Mit dem peinlichen Theaterabend und den Versuchen Franks seine Frau aufzuheitern, beginnt eine Ehekrise, die erst dann beigelegt scheint, als April einen kühnen Plan präsentiert: Raus aus der „spießigen“ Vorstadt, in der die Familien große Schilder wie „The Millers“ vor ihr Anwesen pflanzen, ab nach Paris. Weg von der oberflächlichen amerikanischen Konsumkultur, hinein ins alte, kultivierte Europa. Sie wird dort aufgrund ihrer Sprachkenntnisse als Sekretärin arbeiten, er soll dort seine wahre Berufung finden. Denn dass er zu Höherem geschaffen ist, daran besteht zumindest bei ihm kein bewusster Zweifel. Frank und April geht es gut, als sie sich ausmalen, wie sie ihrer Maklerin Mrs. Givings und dem befreundeten Paar Campbell eine Nase drehen und endlich sich und anderen beweisen, dass sie etwas Besseres sind. Wie der aus Konformität geborene Kampf gegen die Konformität endet, sei hier nicht verraten, auch wenn ich vermute, dass einige bereits die Verfilmung „Zeiten des Aufruhrs“ von 2008 kennen, die ich allerdings nicht gesehen habe.
Dieser aus heutiger Sicht nicht herausragend originell klingende Plot lebt von der absoluten Glaubwürdigkeit der Protagonisten, ihrer Motive, Dialoge und Handlungen. Die Charaktere werden seziert, aber nicht verraten. Yates’ Blick auf seine Figuren ist kühl, aber nicht lieblos, auch wenn er offenbar die meisten Sympathien für den in einem Irrenhaus untergebrachten Sohn der Maklerin zu haben scheint. Die Sprache des Romans ist zwingend, einfach, nie prätentiös und erzählt scheinbar mühelos etwas Trauriges und Wahres über das Leben zweier spezieller Menschen und der Menschheit allgemein. Der Handlungsaufbau ist makellos und mitreißend. Es gibt, anders als bei vielen „großen“ (männlichen) Autoren, keine Spur von Sexismus, Selbstgefälligkeit oder Geschwätzigkeit.
Richard Yates, der „Revolutionary Road“ im Alter von 35 Jahren nach seiner ersten Ehescheidung als sein Romandebut veröffentlichte, wurde früh ein Liebling der Kritiker- und Autorenschaft, verkaufte von den Hardcoverausgaben seiner Bücher aber nie mehr als 12.000 Stück. Schon vor seinem Tod geriet er zunehmend in Vergessenheit, ist aber heute bekannter als je zuvor, nicht zuletzt wegen eines leidenschaftlichen Aufsatzes von Stewart O’Nan, der 1999 in der Boston Review erschien.
Nachtrag: Da ich das Buch sofort nach der Empfehlung haben wollte, habe ich das öde ummantelte “Buch zum Film” gekauft, und muss mir nun die Beschimpfung “Buch-zum-Film-Leser” gefallen lassen.