Wolf Jobst Siedler, Ein Leben wird besichtigt, 2000
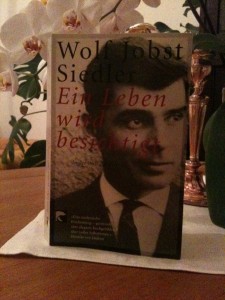
Vielfach liest man, mit dem Bürgertum gehe es demnächst zu Ende. Die deutsche Sprache sterbe aus, sogar die Frau des Bundespräsidenten sei abstoßend tätowiert, niemand könne mehr vernünftig Latein, und unter Bildung missverstünden die Deutschen eine unverstandene Faktensammlung, die höchstens zu Quizsendungen im Privatfernsehen tauge. Gleichzeitig genießt das Bürgerliche ein Ansehen, das zumindest ein wenig naiv anmutet, als sei vor hundert Jahren jedes Gymnasium eine kleine Gelehrtenrepublik gewesen und nicht die protofaschistische, kinderquälende Anstalt, wie sie sich in den damals vermutlich nicht von ungefähr beliebten Schülerromanen der Kaiser- und Zwischenkriegszeit spiegelt. Auch hätten sich früher Familien zu sorgsam komponierten Mahlzeiten zusammengefunden, statt hektisch vor dem Fernseher erwärmte Tiefkühlgerichte zu verzehren, weder Damen noch Herren wären in missgestalteten, bunten Plastiksäcken auf die Straße gegangen, und Ehen hätten lebenslänglich gehalten. Früher sei mithin nicht alles, aber ziemlich viel besser gewesen, und selbst wenn es nicht besser gewesen sei, dann habe es zumindest besser ausgesehen.
Zu den – wenigen – besseren Apologeten einer solcherart verklärt schöneren Vergangenheit zählt die Republik den Westberliner Publizisten und Verleger Wolf Jobst Siedler, und es mag vielleicht im Bezug zu Berlin begründet liegen, wieso Geburtstag um Geburtstag, Besuch für Besuch mehr der erstaunlich zahlreichen Werke dieses Herrn in den Haushalt spült, den der geschätzte Gefährte und ich unterhalten, unterbrochen bisweilen durch Teile des ebenfalls üppig ins Kraut geschossenen Gesamtwerks Joachim C. Fests. Möglicherweise hält man den J. und mich aber auch in an sich nahe stehenden Kreisen für konservativer als wir sind, und so seien an dieser Stelle diejenige der sehr verehrten Leserinnen und Leser, die auch körperlich zu meinen Gästen zählen, gebeten, sich künftig etwas Neues zu überlegen, denn der Unterhaltungswert Siedlers generell, wie speziell dieses ersten Teiles seiner Autobiographie ist diesseits der Grenze, die die Apokalyptiker des Bürgertums vom Rest der Welt trennt, vorhanden, aber durchaus begrenzt.
An Siedlers Leben selbst liegt dieses Missbehagen dabei nicht. Der 1926 in Berlin geborene Verleger blickt auf ein vom Reichtum wie von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts zerklüftetes Leben zurück. Im Westberliner Bezirk Dahlem geboren, war Siedler einige Jahre Schüler einer der bis heute gut beleumdeten Hermann-Lietz-Schulen, wurde wegen kritischer Äußerungen über Hitler und die Erfolgsaussichten des Krieges gemeinsam mit einem der Söhne Ernst Jüngers inhaftiert, verurteilt und kam sodann an die italienische Front. Nach einigen Jahren der Kriegsgefangenschaft in Afrika gelangte Siedler zurück in das zerstörte Berlin. Hier endet der erste Band der Lebenserinnerungen; das Studium an der sich neu formierenden FU und der Aufstieg als Journalist und später als Verleger reißt Siedler nur an und erzählt diesen Abschnitt seines Lebens, wie es scheint, in einem oder mehreren weiteren Werke weiter.
Immer wieder ist das auch durchaus angenehm zu lesen. Die Haftzeit etwa als radikale Erfahrung von Kontrollverlust, die Gefühlsschwankungen, die feinen Abstufungen des Verhaltens der Wärter und Richtenden, ebenso wie alltägliche und anekdotische Beobachtungen im vorkrieglichen Berlin. Sobald sich Siedler aber von der Subjektivität des Erlebens löst, hinterlässt er den Leser halbwegs ratlos: Gern gesteht man Siedler Stolz auf seine teils illustren Vorfahren zu, zu denen an prominentester Stelle der Bildhauer Schadow gehört. Wer wäre man auch, es Siedler nicht durchgehen zu lassen, über seine Familie, deren Verbindungen und Herkommen mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu berichten, das in mehr oder weniger expliziter Form jede Familie pflegen dürfte. Sich auf seine Familie etwas einzubilden, ist gerade dann verständlich, wenn diese Familie auch einiges zu bieten hat an Kaufhauskönigen und Generälen, Diplomaten und Professoren. Muss aber – so fragt man sich nach einer kleinen Weile – Siedler immerzu und alle paar Seiten von seiner Familie sprechen? Geht es auch etwas weniger lautstark? Anders als man in Kreisen konservativer Publizistik annimmt, halte ich Bescheidenheit nicht gerade für eine Tugend, die das Bürgertum vor anderen Teilen der Gesellschaft auszeichnet, das ganze 19. Jahrhundert ist, wie man sagt, nur durch bürgerliche Geltungssucht zu erklären, ich habe auch nichts gegen Repräsentation, aber über weite Teile des Buches überschreitet Siedler die Grenze zwischen berechtigtem Stolz und purer Eitelkeit doch etwas zu häufig, um noch Freude zu bereiten. Wir wissen’s, sagt sich der Leser seufzend und blättert halb konzentriert weiter.
Ähnlich steht es mit Siedlers Freunden und Bekannten. Streckenweise liest sich das Buch wie mancher Bericht der Klatschpresse über eine Premiere oder eine königliche Hochzeit als eine Aufzählung von Namen, Namen und wiederum Namen. Von Carl Schmitt über Dacia Maraini, von Thomas Mann, Heinrich Böll, Alexander Solschenizyn bis Hans Wallenberg und immer wieder Joachim Fest und taucht jeder auf, von dem man in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts sprach. Gesehen wurde auch …., denkt man sich, wartet auf eine prägnante Anekdote, etwas Charakteristisches, Interessantes, aber Siedler ist oft längst woanders. Ihm reicht wie manchem kleinen Mädchen am roten Teppich der Berlinale das Auftauchen der Berühmtheit. Dies ist einigermaßen sonderbar: Siedler ist schließlich nicht irgendwer. Dass der Verleger des Propyläen-Verlags, später des Siedler Verlags, ein Fixpunkt des insgesamt überschaubaren Kulturlebens der Bonner Republik, alles und jeden kannte, der eine Schreibmaschine zu bedienen wusste, erwartet man nicht anders. Die schiere Renommiersucht kann es damit eigentlich nicht sein, die Siedler zu diesen Aufzählungen treibt, allerdings ist ein anderer Antrieb vielfach schlechthin nicht erkennbar.
Die Zitiersucht dagegen sei Siedler nachgesehen. Es zeugt von einigem Selbstbewusstsein, um es vorsichtig auszudrücken, als ersten Satz seiner Erinnerungen zu Thomas Manns berühmter Eröffnung des Josephsromans zu greifen, doch mag es für einen Mann, der sein Leben zwischen Büchern verbracht hat, nur natürlich anmuten, entlang von Büchern zu erinnern und zu empfinden. Das Bewusstsein, als bürgerliches Fossil zwischen Plebejern zu wandeln, durchzieht die Autobiographie dabei indes nicht nur als ausdrückliche und stetig wiederholte, bisweilen durchaus ein wenig selbstgefällige Aussage. Man mag darüber streiten, ob diese Annahme überhaupt zutrifft, Siedler jedenfalls hat dieser Glaube an den abgesunkenen Bildungsstand seiner Leser zu einer etwas sonderbaren Vorgehensweise bewogen: Er erklärt annähernd jedes Zitat in der ängstlichen Annahme, der Leser könne vielleicht andernfalls annehmen, die Herzogin von Guermantes sei keine Schöpfung von Proust, sondern vielleicht von Courths-Mahler, und wenn er das berühmte Bild des nächtlichen Albs heraufbeschwört, vergisst er nicht hinzuzufügen, jenes sei von Füssli.
Auf den letzten Seiten wird Siedler kokett. Er werde sich hüten, schließt er, das Buch mit einem Finis zu beenden, erst recht aber schließe er nicht mit Fortsetzung folgt, und man klappt das mit einer Abbildung des Autors in jungen Jahren geschmückte Geschenk zum vorletzten Geburtstag kopfschüttelnd zu. Ich habe die Fortsetzung nicht gelesen. Mir schwant, ich habe nichts verpasst.
 Als Kind schon war ich schwer auf drauf, dauernd auf der Suche nach Lesestoff, koste es, was auch immer. Man mag es an diesem frühen Bild bereits erkennen. Early Adopter, oder wie nennt man das? The Portrait of the Artist as a Young Addict? Wie auch immer, in jungen Jahren trieb mich die Not zu seltsamen Beschaffungsstrategien. Der Zufall hatte mich in einen Haushalt mit nur wenig Büchern gesperrt, mich gleichzeitig aber als eine Art Leseüberflieger gestaltet, sodass ich die zur Verfügung gestellten Kinderbilderbücher schnell satt hatte. Möglich ist auch, dass die vielen ungelesenen Sternausgaben, die mir zum Zerfetzen in den Laufstall geworfen wurden, ihren Anteil an dieser fatalen Entwicklung hatten.
Als Kind schon war ich schwer auf drauf, dauernd auf der Suche nach Lesestoff, koste es, was auch immer. Man mag es an diesem frühen Bild bereits erkennen. Early Adopter, oder wie nennt man das? The Portrait of the Artist as a Young Addict? Wie auch immer, in jungen Jahren trieb mich die Not zu seltsamen Beschaffungsstrategien. Der Zufall hatte mich in einen Haushalt mit nur wenig Büchern gesperrt, mich gleichzeitig aber als eine Art Leseüberflieger gestaltet, sodass ich die zur Verfügung gestellten Kinderbilderbücher schnell satt hatte. Möglich ist auch, dass die vielen ungelesenen Sternausgaben, die mir zum Zerfetzen in den Laufstall geworfen wurden, ihren Anteil an dieser fatalen Entwicklung hatten.
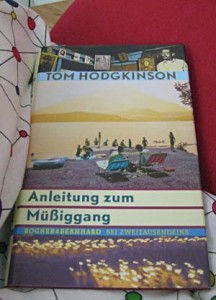 Diese elende Welt ist eingeteilt in Leistungsträger und Minderleister, in Sieger und Versager also, in Schwätzer und Schweiger nicht zuletzt. So zumindest scheint es mir in letzter Zeit. Zudem verkommt das Buchstabengepixel im Internet, genau wie auch Edelgedrucktes auf Papier, mehr und mehr zu einer doch recht armseligen Meinungsverkündigung. ICHICHICH, in enge Schleifen gelegt, schließlich muss alles nicht nur einmal, sondern am besten gleich hundertfach irgendwo verewigt sein. Und zwar einzig und allein, weil man es angeblich jetzt endlich wieder darf. Was auch immer damit gemeint sein mag.
Diese elende Welt ist eingeteilt in Leistungsträger und Minderleister, in Sieger und Versager also, in Schwätzer und Schweiger nicht zuletzt. So zumindest scheint es mir in letzter Zeit. Zudem verkommt das Buchstabengepixel im Internet, genau wie auch Edelgedrucktes auf Papier, mehr und mehr zu einer doch recht armseligen Meinungsverkündigung. ICHICHICH, in enge Schleifen gelegt, schließlich muss alles nicht nur einmal, sondern am besten gleich hundertfach irgendwo verewigt sein. Und zwar einzig und allein, weil man es angeblich jetzt endlich wieder darf. Was auch immer damit gemeint sein mag.
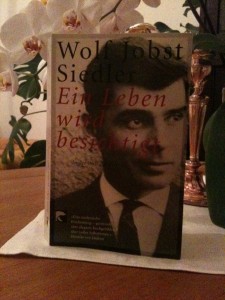
 Jeder kennt das. Lesen oder nicht lesen, das ist häufig die Frage. Denn Lesezeit ist Lebenszeit. Und Lesen braucht viel Zeit, mitunter. Besonders, wenn man lesen muss. Aber muss man? Wirklich?
Jeder kennt das. Lesen oder nicht lesen, das ist häufig die Frage. Denn Lesezeit ist Lebenszeit. Und Lesen braucht viel Zeit, mitunter. Besonders, wenn man lesen muss. Aber muss man? Wirklich? Es gibt Leute, die die Klagenfurter „Tage der deutschsprachigen Literatur“, vulgo den Bachmannpreis, leben und feiern wie andere Leute (viel, viel mehr Leute) die Fußballweltmeisterschaft – ein mir ausgesprochen sympathisches Spinnertum. Seit 2004 gehört auch Angela Leinen dazu, die ich als Autorin des Blogs
Es gibt Leute, die die Klagenfurter „Tage der deutschsprachigen Literatur“, vulgo den Bachmannpreis, leben und feiern wie andere Leute (viel, viel mehr Leute) die Fußballweltmeisterschaft – ein mir ausgesprochen sympathisches Spinnertum. Seit 2004 gehört auch Angela Leinen dazu, die ich als Autorin des Blogs