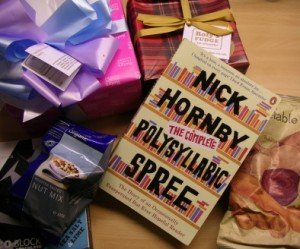Post-Gastarbeiter-Literatur
11. March 2012 | von KaltmamsellPia Ziefle, Suna
Pia Ziefle kenne ich aus dem Internet, als Blogautorin und als Kommentatorin in meinem Blog. So wusste ich schon lange, dass Abstammung aus verschiedenen Kulturen sie beschäftigt. Jetzt ist aus dieser Beschäftigung ein Roman geworden, der wohl das Dichteste, Kräftigste und Kunstfertigste ist, was ich seit Langem an deutscher Literatur gelesen habe.
Westliche Literatur, die aus einer Geschichte von Migration und Mischung verschiedener Historien und Kulturen entsteht, kenne ich aus Großbritannien: Dort hat postcolonial literature seit Jahrzehnten eine auch literaturwissenschaftlich erfasste eigene Tradition. Beispiele reichen von Doris Lessing über die Bücher von Salman Rushdie bis zu Andrea Levy, Small Island. Das Pendant in Deutschland beginnt sich gerade erst zu bilden, ich nennen es testweise Einwandererliteratur. (Ist eine Germanistin im Raum, die mir den Stand der Forschung berichten kann und ob es vielleicht schon einen üblichen Terminus gibt?) Und Pia Ziefles Suna beweist aufs Großartigste, wie groß die literarische Lücke ist, die durch dieses Genre gefüllt werden muss.
Die deutsche Gesellschaft und vor allem die Politik haben sich viele Jahrzehnte lang dem Umstand verweigert, dass Deutschland ein Einwanderungsland war und ist. Die Konsequenzen dieser Verweigerung baden wir gerade aus und werden es noch lange tun. Die literarische Verarbeitung dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit ist sicher nicht der schlechteste Weg, die Komplexität der deutschen Einwanderungsgeschichte sichtbar zu machen.
Suna tut das auf ganz individuelle Art. Die Hauptperson und Erzählstimme, Luisa, erzählt ihre höchst besondere Geschichte. Sie ist einerseits nicht denkbar ohne die Ereignisse im Nachkriegsdeutschland, andererseits aber überhaupt nicht repräsentativ für eine Generation oder auch nur beispielhaft für eine Gruppe von Menschen – und macht dadurch die Vielfalt von Auswirkungen erlebbar. In den sieben Nächten vor ihrer Reise in den Heimatort ihres leiblichen türkischen Vaters erzählt Luisa ihrer kleinen Tochter die Geschichte ihrer Vorfahren, einschließlich ihrer selbst. Luisa ist eine gequälte Seele, die nicht nur die eigenen Narben einer Aufgabe durch die leiblichen Mutter und der Zerrissenheit zwischen verschiedenen Familien trägt, sondern auch die Last ihrer Vorfahren: Der jugoslawischen Seite mit Armut und Existenzkampf bis hin zum Bürgerkrieg. Der türkischen mit Entwurzelung, Enttäuschungen und Abfinden mit Unausweichlichem. Der deutschen Adoptivfamilie, gelähmt vom Trauma des Zweiten Weltkriegs, den Gräueln und der Schuld.
Mir wurde überraschend klar, wie eng deutsche Kriegserlebnisse und Vertreibung mit der Gastarbeiterzeit verwoben sind. Dabei hätte mich das eigentlich nicht wundern sollen, denn mein spanischer Gastarbeitervater hat die 1945 geborene Tochter einer polnischen Zwangsarbeiterin geheiratet, sein bester Freund, ebenfalls Gastarbeiter aus Spanien, eine Vertriebenentochter aus Schlesien. Dennoch ist mir erst durch Suna bewusst geworden, dass es keine Generation dazwischen gab, dass die Einwanderer der 60er und 70er Jahre in Deutschland auf Menschen trafen, die durchwegs vom Krieg traumatisiert waren. (Dabei hatte mir mein Vater doch noch erzählt, wie seine ersten deutschen Kollegen in der Nürnberger Fabrik ihm den Tipp gaben, sich gegen die Kälte mit Zeitungswickeln unter der Hose zu wappnen – das hatten sie im Krieg in Russland gelernt.)
Die Erinnerungen der Erzählerin in Suna sind dicht und reich. Kapitelweise und darin abschnittsweise wechselt die Szene, wechselt die Zeit. Verschiedene chronologische Erzählstränge greifen die Geschichten von deutschen Adoptiveltern, von jugoslawischer Mutter auf und vom türkischen Vater. Dazu kommt Luisas Geschichte ab dem Moment eigener Erinnerungen – je älter und bewusster Luisa wird, desto größeren Raum nimmt ihr Leben in der Erzählung ein. Am Ende des Romans haben alle Erzählstränge zueinander gefunden und verknüpfen sich. Die große Begegnung aber bleibt ausgespart, wir bekommen glücklicherweise keine Erlösung oder Heilung geliefert.
Die sprachlichen Mittel wechseln dabei ebenso reich je nach Zeit und Szene, setzen den Tonfall und die Stimmung. Meist wird sehr mündlich und leicht erzählt, doch es scheinen Märchenwendungen auf (der Rahmen der sieben Nächte lässt ohnehin Sheherazade anklingen), andere Passagen bestehen aus innerem Monolog und fast freier Assoziation.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Klappentext die richtigen Leser anspricht: „Was alles aus Liebe geschieht – eine deutsch-türkisch-jugoslawische Familiengeschichte“ – der Roman ist so groß und wichtig, dass er dringend in die Feuilletons der großen Tageszeitungen gehört (Herr Seibt?).