Johanna Straub: Das Beste daran
9. September 2010 | von Isa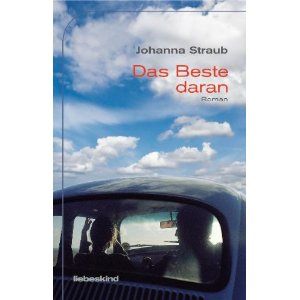 Der Roman beginnt so:
Der Roman beginnt so:
Sonst, wenn sie zu Hause sind, ist er derjenige, der anfängt, der weiß, wie es geht, die Zeit zwischen ihnen anzuhalten, derjenige, der Berührungen verwandelt in solche, die das Gegenteil von flüchtig sind und wichtig und unabdingbar, wenn er seine Hand auf ihren Bauch legt, liegen lässt, schwerer werden lässt und nach oben streicht, das Hemdchen, das sie beim Schlafen trägt, zusammen mit ihrem leichtern Widerstand beiseiteschiebt wie einen lästigen Schleier, während er etwas in ihr Ohr flüstert, das sie zum Lachen bringt, weil es sie kitzelt und weil Lachen vielleicht dagegen hilft, dass sich all die kleinen Härchen in ihrem Nacken aufrichten und dass ihre Knie weich werden, das dürfen sie jetzt, weil sie liegt, und die Knie müssen sie gerade nicht tragen, ihre Arme können sich um seinen Nacken schließen, ihre Augen dürfen zufallen und seine dann auch, und die Bilder der Gedanken dürfen blasser werden, bis es dahinter hell wird, weiß und gleißend, und die Struktur nachlässt, bis es eine helle, weiße Fläche wird, in der sie sein können, ohne dass da noch irgendetwas anderes wäre außer dem Licht, von dem da so viel ist, und noch mehr – aber jetzt ist sie diejenige …
Ui, jetzt so beim Abtippen klingt das ja erstens nach höllenlangen Sätzen und zweitens ein bisschen esoterisch mit dem Licht und dem Weiß und so. Aber so ist das gar nicht.
Jette und Marvin, Mo, Ruben, Per, Anna, Alexandra und die anderen sind alle in dem Alter, in dem man sich mal entscheidet. Wer jemanden hat, muss entscheiden, ob man zusammenbleibt, und wenn ja, ob man Kinder bekommt (und was man tut, wenn es nicht klappt). Wer niemanden hat, sucht. Und alle haben eine Vergangenheit, in die wir auch einen Blick werfen.
Ich musste beim Lesen immer wieder an PeterLichts Trennungslied denken; hier geht es zwar nicht um Trennung, sondern um das zwischen den Trennungen, um die Beziehungen nämlich, aber es ist ein ebensolcher Reigen wie bei PeterLicht: einer kennt den anderen, aber seine Frau nicht, die wiederum mit der nächsten befreundet ist und in der Vergangenheit wieder mit einem anderen zusammen war, und so weiter. Natürlich läuft keine Beziehung einfach so rund, jede hat ein anderes Problem, jede geht anders mit ihren Themen um.
Und wenn ich neulich über Judith Schalanskys Matrosenroman schrieb, man habe da einen Haufen Puzzlestücke in der Hand, die kein Bild ergeben, so hat man hier ebenfalls Puzzlestücke, die aber ein sehr genaues Bild ergeben. „Portrait einer Generation“ steht hinten drauf, das mag eine abgedroschene Worthülse sein, stimmt aber. Sehr schönes Buch, sehr gut zu lesen.
Johanna Straub steht im Regal zwischen Bram Stoker und Botho Strauß.
Johanna Straub: Das Beste daran. 221 Seiten. Liebeskind, 16,90 €




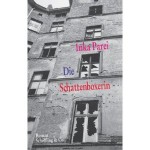


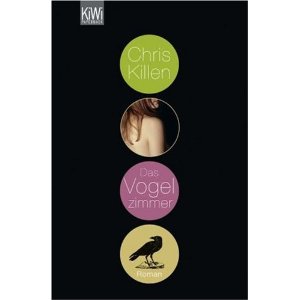
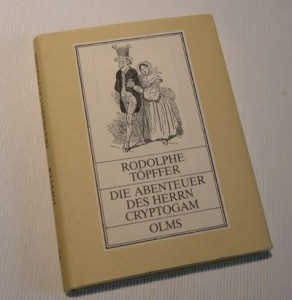


 Der Roman beginnt so:
Der Roman beginnt so: